Veröffentlichungen
April 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Spielhofer, L., Babrios. Ein Interpretationskommentar zu den Prologen und Fabeln 1 bis 17. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2023. Hermes Einzelschrift Bd. 125. EUR 66,- (ISBN 978-3-515-13515-3).
Die Forschung rechnet den Fabeldichter Babrios üblicherweise nicht zu den Autoren der traditionellen antiken Literatur, er gehört damit auch nicht zum Kanon der Schriftsteller, die in Schule und Universität gelesen werden. Albrecht Dihle nennt in seinem Überblickswerk (Griechische Literaturgeschichte, Stuttgart 1967) diesen Dichter mit keinem Wort, dagegen erwähnt Martin Hose ihn in seiner Literaturgeschichte mit einigen Sätzen (Ders., Kleine griechische Literaturgeschichte. Von Homer bis zum Ende der Antike. C. H. Beck Verlag: 1999, 164-165) und schneidet Detailfragen an, mit denen sich die heutige Forschung beschäftigt. Der Münchner Klassische Philologe Niklas Holzberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fabeldichter Babrios den ihm zustehenden Platz einzuräumen. Er beklagt in der Einführung zu seiner zweisprachigen Ausgabe des Babrios (Ders., Babrios, Fabeln. Griechisch-deutsch. De Gruyter, Sammlung Tusculum: Berlin/Boston 2019, 9-47) mit voller Berechtigung die Geringschätzung dieses Dichters seitens der Gräzistik: „In der gesamten Weltliteratur dürfte es keinen Autor von hohem künstlerischem Rang geben, der von der zuständigen Wissenschaft (…) so hartnäckig vernachlässigt (ja im Grunde ignoriert) wurde wie der besonders durch sein Erzähltalent und seinen skurrilen Witz faszinierende Fabeldichter Babrios“ (Holzberg, 9). Lukas Spielhofer (S.) unternimmt es in seiner Grazer Dissertation mit großem Engagement, zentrale Fragen der Babriosforschung aufzugreifen und den Diskurs zu beleben. Er bereitet den ausführlichen Kommentarteil systematisch vor, denn vor der Interpretation der beiden Prologe und der ausgewählten Fabeln ist es von entscheidender Bedeutung, grundlegende Fragen zu klären, damit die Leserinnen und Leser die Überlegungen des Interpreten nachvollziehen können.
Bereits in der Einleitung (1. Kapitel, 9-11) schneidet S. einige wichtige Einzelheiten an; so weist er daraufhin, dass die Erstausgabe der Mythiamboi, eine Sammlung griechischer Versfabeln, 1844 in Paris publiziert wurde. Er beklagt ebenso wie der bereits erwähnte Niklas Holzberg, dass die Fabeln des Babrios in den letzten 180 Jahren kaum beachtet wurden. Die Lage bei einem anderen bedeutenden Fabeldichter, nämlich dem Römer Phaedrus, ist da deutlich günstiger einzuschätzen, nicht zuletzt aufgrund intensiver Forschungen von Ursula Gärtner. Inzwischen liegen von ihr zu den ersten drei Büchern der Phaedrusfabeln Interpretationskommentare vor. Im zweiten Kapitel liefert S. interessante Informationen über den Dichter, sein Werk und die Überlieferung (12-36). Da wir über Babrios fast nichts wissen, stellt S. zu Beginn des Kapitels folgendes lapidar fest: „Dem Autor der Babriosfabeln ein eigenes Kapitel zu widmen, stellt ein kühnes, ja fast hoffnungsloses Unterfangen dar. Wir haben es im Falle der Fabelsammlung im wahrsten Sinne mit einem auteur mort nach Roland Barthes zu tun“ (12). Insofern ist es auch sehr schwierig, das Werk und seinen Autor genau zu datieren. Die Vorschläge bieten einen zeitlichen Rahmen vom dritten vor- bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert (12). Die Widmungen in den beiden Prologen helfen nicht weiter; im ersten Prolog spricht der Erzähler eine Person an, die sich historisch nicht einordnen lässt: ὦ Βράγχε τέκνον, im zweiten wendet er sich an einen gewissen Alexander: βασιλεὺς Άλέξανδρος. Auch dieser ist historisch nicht fassbar. Eine Mehrheit der Forscherinnen und Forscher setzt die Publikation der Sammlung auf das erste bzw. zweite Jahrhundert n. Chr. an, einige plädieren für das dritte Jahrhundert und vermuten die Zeit der Severer (12/13). S. hat natürlich auch einen Blick auf die antiken Quellen geworfen; in einem Brief des Kaisers Julian aus dem Jahr 362 werden die Fabeln des Babrios zum ersten Mal genannt, ebenso in der Praefatio zur Fabelsammlung Avians (um 400 n. Chr.). S. führt weitere Textzeugen an, die aber alle keine genaue Datierung zulassen. Daher liegt es nahe, sprachliche und stilistische Eigenheiten der Texte des Fabeldichters zu prüfen. Einige Anhaltspunkte sprechen für eine Einordnung in die Kaiserzeit, und zwar in die Zeit der Zweiten Sophistik. Babrios bedient sich der Koine „mit ionischen Einflüssen“, daneben lassen sich nachklassische Phänomene sowie die Verwendung von Neologismen beobachten. Letztendlich glaubt S. an eine Entstehungszeit, die im zweiten, eher noch in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts anzusetzen ist (15). Auch aus den Fabeln selbst können keine gesicherten Fakten bezüglich der genauen Lebenszeit des Dichters erschlossen werden. Ebenfalls über das Einflussgebiet des Fabeldichters können nur Vermutungen angestellt werden; manches spricht für das Gebiet des heutigen Syrien, zumindest für das östliche Mittelmeergebiet (18). S. hat die vorhandenen Angaben genau geprüft und möchte sich nicht an Spekulationen beteiligen.
Im ersten Unterabschnitt von Kapitel zwei erläutert er den Überlieferungsstand der Mythiamboi (18-27), vergleicht sie mit anderen antiken Sammlungen und geht auch auf die Frage ein, ob die Epimythien, die sich nicht bei allen überlieferten 144 Fabeln finden, ursprünglich vom Autor verfasst wurden oder eher als Nachtrag anzusehen sind, denn für das Verständnis sind sie meist unwichtig oder widersprechen sogar dem Inhalt der Fabeln (22). S. erinnert daran, dass Forscher wie Ben Edwin Perry, John Vaio, Antonio La Penna und Maria Jagoda Luzzatto wichtige Beiträge im Zusammenhang mit der Textkritik, der Übersetzung und der Klärung weiterer Details geleistet haben (24). Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang die sehr ausführliche und instruktive Einleitung, die Niklas Holzberg seiner zweisprachigen Babriosausgabe vorgeschaltet hat (s.o.). S. möchte mit seiner Studie ein Desiderat beseitigen, denn aktuell fehlt ein Gesamtkommentar zu den Fabeln des Babrios, auch die Poetologie dieser Texte ist noch nicht genau analysiert. Im nächsten Unterabschnitt von Kapitel zwei stellt S. den literarischen Kontext vor (27-36) und klärt zunächst die Frage, warum die Fabeln des Babrios „überhaupt unter literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten untersucht“ werden sollen (27). Moderne Analysen belegen nach Ansicht von S., dass die Versfabeln in einer beachtlichen Tradition stehen und „literarische Ansprüche erheben“ (27). Auf einige Besonderheiten der Fabeln des Babrios macht er aufmerksam; so beruft sich der Fabeldichter zwar auf die äsopische Fabeldichtung, greift aber auf nichtgriechische Traditionen zurück und bedient sich anderer literarischer Gattungen, so dass komplett neue Fabeln entstehen (28). Auffallend ist der Gebrauch des Choliambus, die Babrios in seinen Fabeln verwendet. Damit steht er in der Tradition der Spottdichtung, etwa in der von Hipponax (6. Jahrhundert v. Chr.) oder auch schon von Archilochos (7. Jahrhundert v. Chr.).
Im dritten Kapitel: Die Sammlung – Aufbau und Struktur (37-50) geht S. auf die Anordnung der Fabeln ein und tendiert dazu, die weitgehend alphabetisch orientierte Grundstruktur als vom Autor intendiert anzunehmen. Vor allem die Annahme, „dass sich das literarische Spiel des Autors mit dem didaktischen und enzyklopädischen Anspruch, den ein antikes Publikum in der Zeit der Zweiten Sophistik an eine Fabelsammlung gestellt haben dürfte, in der Struktur des Fabelbuchs widerspiegelt, würde eine verlockende Erklärung darstellen“ (41). Details zum Gedichtbuch (41-49) bietet S., um anschließend seine Schlussfolgerungen vorzustellen (49-50).
S. entfaltet seine Überlegungen zum poetischen Programm im vierten Kapitel (51-71). Darin geht er zunächst auf den Dichter und sein Publikum (51-56), auf Vorbilder und Nachfolger (56-60), auf die Poetologische Bildsprache (60-69), um dann, auch wie in anderen Abschnitten, seine Beobachtungen zusammenzufassen (70-71). Einige wenige Details aus diesem Kapitel seien kurz genannt, da sie dazu dienen, die im Kommentar präsentierten Analysen besser einordnen zu können. Wenn S. vom Dichter Babrios spricht, dann meint er den „diegetischen Erzähler bzw. das Ich“ (51), das vor allem in den beiden Prologen sichtbar wird. Am Anfang des zweiten Prologs liefert das Ich eine knappe Geschichte der antiken Fabel, Aesop stehe in einer langen Tradition, die auch Vertreter nichtgriechischer Provenienz kennt, ja das Ich führt sogar einen syrischen Fabeldichter an, der zur Zeit des Ninos und des Belos lebte (V. 2/3). Babrios postuliert einen Originalitätsanspruch, denn er habe zwei Gattungen, die Fabel (μῦθος) und den Iambos (ἴαμβος), miteinander verbunden und damit einen neuen Fabeltypus geschaffen, nämlich: die Mythiamben (58). Die Leserinnen und Leser sind bei der Lektüre der Fabeln gefordert, denn sie sollen die darin getroffenen Aussagen ständig evaluieren und „Behauptungen über Intention oder Eigenschaften des Werkes auf ihre Gültigkeit (…) überprüfen“ (60). Die Untersuchungen von S. ergeben, dass Babrios auf sprachliche Bilder zurückgreift, mit denen er Charakteristika seiner Fabeln beschreibt. Ein Bereich, auf den das Ich gerne rekurriert, ist die Sphäre von Flora und Fauna; die Biene spielt schon seit der frühgriechischen Dichtung eine entscheidende Rolle, wenn der poetische Schreibprozess des Dichters illustriert werden soll (Anm. 54, S. 61). Mit einem anderen Motiv wird die Leistung B. s als „zart bzw. fein“ (65) umschrieben. Ein weiterer Bereich der Sprache vermag die Arbeit des Fabeldichters als Handwerker darzustellen. Metaphern aus dem Umfeld der Metallverarbeitung gehen zum Beispiel auf Pindar zurück, der zur Exemplifizierung seines Dichterkönnens den Vergleich mit einem Handwerker nicht scheut, der Metall schleift oder seine Produkte mit Gold veredelt (Pind. O, 6,82 oder auch N. 4, 82-83a) (66). Das fünfte Kapitel steht im Zeichen Literarischer und narrativer Strategien (72-85). Bezüglich der Akteure greift Babrios auf ein großes Spektrum zurück, denn im Gegensatz zu manch populärer Meinung, in Fabeln spielten nur Tiere eine Rolle, findet man in seinem Werk auch Menschen, Figuren aus der Mythologie, Pflanzen und Gegenstände (72). Die Fabeln der Mythiamboi spielen sämtlich in der Goldenen Zeit; hier können alle Protagonisten miteinander in derselben Sprache kommunizieren. Besonders fällt die ausgeprägte Rhetorisierung der Fabeln des Babrios auf (75-76). S. konstatiert eine nicht zu übersehende Erzählfreude des Dichters und eine teilweise detailreiche Beschreibung von Personen oder Situationen (76). Sehr auffällig ist die sogenannte Dekonstruktion, die Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren auch bei anderen Fabeldichtern beobachtet haben. Damit ist das Phänomen gemeint, dass die Erwartungen der Leserinnen und Leser systematisch enttäuscht werden, ja es gibt sogar Widersprüche zwischen den Teilen eines Werkes, in denen der Dichter sein poetisches Programm entfaltet, und den Realisierungen in den Fabeln, die dazu im Widerspruch stehen. Im Fall des Babrios kann festgestellt werden, dass der Dichter in den beiden Prologen Versprechungen macht, die er in den Fabeln nicht einhält. In einer übersichtlichen Tabelle hat S. Auffälligkeiten diesbezüglich dargestellt (80/81). Ein Beispiel mag dies belegen; im ersten Prolog spricht das Ich von einer Harmonie zwischen Menschen und Tieren, gleich in der ersten Fabel benutzt ein Jäger einen Pfeil, um Tiere zu töten.
Das zentrale sechste Kapitel enthält den Kommentarteil zu den beiden Prologen und den ersten 17 Fabeln (86-291). S. erläutert zunächst seine methodischen Überlegungen (86-87), um den Leserinnen und Lesern seine Vorgehensweise transparent zu machen. Die Abschnitte sind gut strukturiert und nach denselben Merkmalen aufgebaut; erst wird der griechische Text geboten, wobei neben den Versen Hinweise auf die benutzten Ausgaben geliefert werden. Dann folgt eine eigene Übersetzung des Autors, wobei er nicht auf die jüngst erschienene Übersetzung von Niklas Holzberg (s.o.) zurückgreift, sondern den Fokus auf einen bestimmten Aspekt richtet, nämlich darauf, „die ursprüngliche Textgestaltung möglichst genau wiederzugeben, weshalb auf stilistische Anpassungen und Abweichungen vom Ursprungstext großteils verzichtet wurde“ (86). Daran schließen sich jeweils ein Abschnitt über die Gliederung der Fabel, der Kommentarteil/Analyse, Hinweise auf Parallelen und eine Gesamtbetrachtung an.
Besonders problematisch ist die Interpretation des ersten Prologs, vor allem, weil es stark voneinander abweichende Überlieferungen gibt (95). Zahlreiche Forscherinnen und Forscher haben sich mit diesem Text intensiv auseinandergesetzt, auf deren Ergebnisse S. zurückgreifen konnte. Sehr lesenswert und kenntnisreich ist der Abschnitt: Analyse (94-105). Auf Details kann ich hier aus Platzgründen nicht näher eingehen, empfehle aber nachdrücklich die Lektüre. Aus schulischer Sicht ist der Prolog schon deshalb von großem Interesse, da in ihm der Weltaltermythos geschildert wird. Man kann diese Variante gut mit den bekannten Darstellungen zum Beispiel von Hesiod, Ovid oder auch Kallimachos vergleichen, auf dessen Iamboi Babrios zurückgreifen konnte. S. arbeitet die Parallelen zwischen den beiden Fassungen von Kallimachos und Babrios gut strukturiert heraus (105-107).
Dass eine Interdependenz zwischen dem ersten Prolog und der Fabel Nr.1 existiert präpariert S. nachvollziehbar heraus. Erwartungen, die im Prolog geweckt wurden, werden mehrmals enttäuscht oder sogar ins Gegenteil gewendet. Da im Eingangstext epische Elemente vorhanden sind, könnte der Leser/die Leserin darauf hoffen, dass es in der ersten Fabel um eine wichtige Schlacht geht. Doch der Löwe ergreift die Flucht und begegnet dem Fuchs. Babrios bedient sich bei der Schilderung eindeutig homerischer Wendungen; als Beispiel lässt sich die Verknüpfung von προκαλέομαι (Babr. 1, V. 4) mit dem Verb μάχεσθαι (Babr. 1, V. 5) anführen; in Versen des Homer finden sich dieselben Kombinationen (Hom. Il, 3-432-433; 7,39-40, Anm. 226, S. 126). Während in anderen antiken Texten der Löwe „Tapferkeit, Stärke und Mut“ symbolisiert (126) und von den Dichtern gerne in epischen Vergleichen eingesetzt wird, enttäuscht bei Babrios der Löwe die Leserinnen und Leser und flieht. Eine andere Täuschung besteht darin, dass die Beschreibung des Goldenen Zeitalters die Erwartung evoziert, in den folgenden Fabeln herrsche eine ähnliche Situation vor. Bereits in der ersten Fabel wird dieses Wunschdenken konterkariert, denn es herrscht Gewalt zwischen Mensch und Tier, ja sogar unter den Tieren. Auf weitere Widersprüche, die S. beobachtet, gehe ich hier nicht ein (vgl. S. 134). Vergleichend arbeitet S. auch bei der Analyse und Interpretation der anderen Fabeln, wobei er immer wieder auf Querverbindungen aufmerksam macht. Zahlreiche Fabeln weisen gemeinsame Elemente und Vor- bzw. Rückverweise auf, so dass die Annahme berechtigt erscheint, dass die vorliegende Sammlung so auch vom Autor intendiert war.
S. erhebt keinen Anspruch darauf, seine Resultate uneingeschränkt auf die anderen Fabeln zu übertragen, sondern empfiehlt weitere Studien, die das Gesamtwerk des Babrios in den Blick nehmen könnten.
Das achte Kapitel beinhaltet Verzeichnisse (294-310) mit Abkürzungen, Hinweise auf Textausgaben, Kommentare und Übersetzungen der Mythiamboi sowie Textausgaben antiker Autoren und Werke, ein Tabellenverzeichnis und die Sekundärliteratur. Den Abschluss bildet das Register (311-335) mit dem Stellenregister und dem Personen-, Orts- und Sachregister.
Abschließend lässt sich konstatieren, dass S. eine vorzügliche Studie zum Werk des Fabeldichters Babrios vorgelegt hat, denn er bringt den wissenschaftlichen Diskurs voran, offeriert den griechischen Text samt eigener Übersetzung, legt gut nachvollziehbare Interpretationen vor, geht auf zentrale Fragen der Babriosforschung ein und erarbeitet neue Einsichten bezüglich der Struktur der Fabeln, ihrer literarischen Architektur und Poetologie. Mit seinem Opus hat S. eine solide Basis für eine moderne literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung der Mythiamboi geschaffen.
Rezensent: Dietmar Schmitz
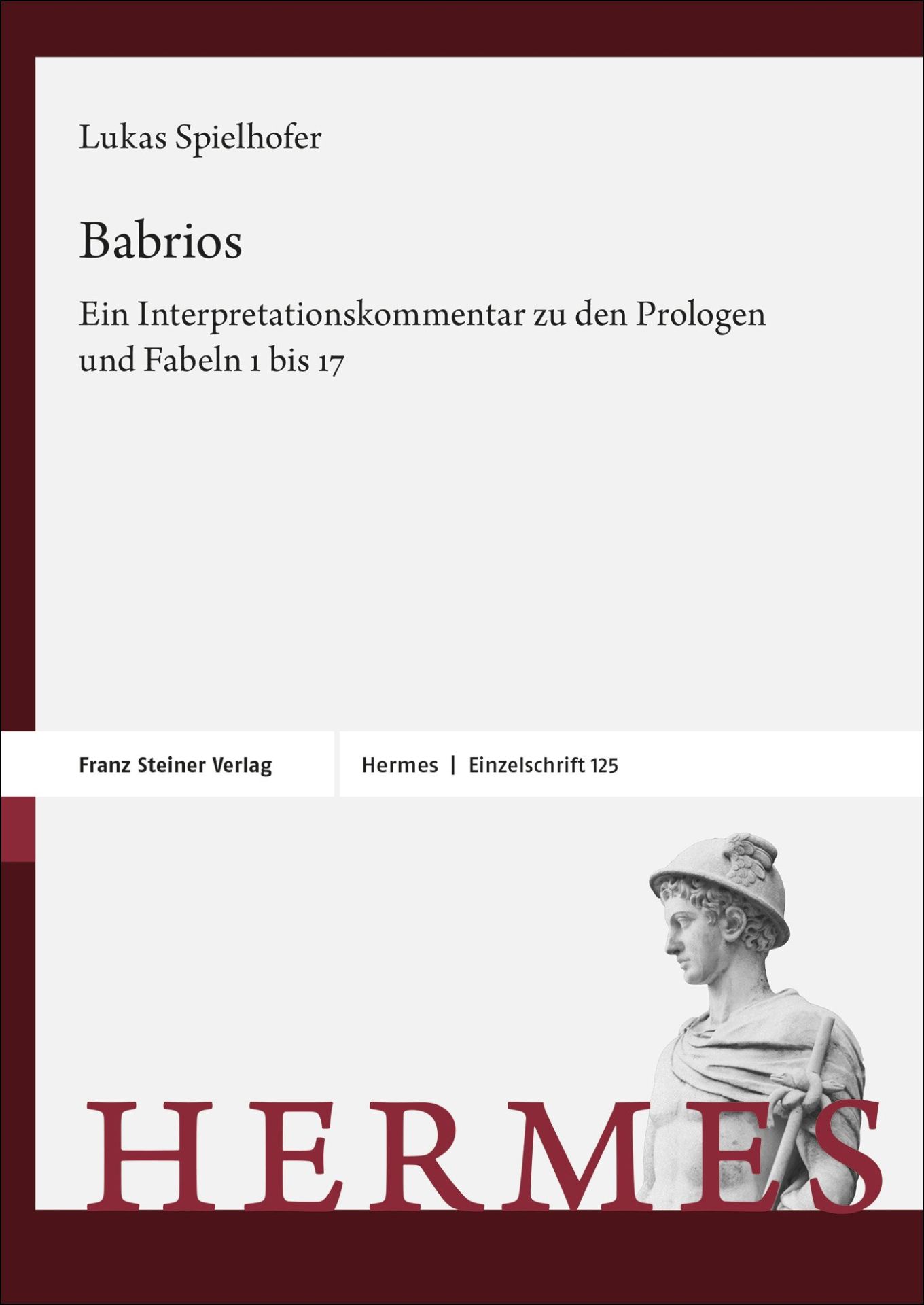
Februar 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Kirchner, R., (2022), Protreptik und Rhetorik. Werbung für die Beredsamkeit in der römischen Literatur. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 249 S. EUR 50,- (ISBN 978-3-515-13291-6).
Die vorliegende Studie ist eine Habilitationsschrift, die 2020 von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena angenommen wurde. In der Einleitung (11-12) stellt Roderich Kirchner (K.) klar, dass die antike Rhetorik Teil des Erziehungswesens der Antike war. Bereits in der ersten Anmerkung verweist K. auf wichtige Literatur zum Thema (etwa: J. Christes/R. Klein/ Chr. Lüth (Hrsgg.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike. Darmstadt 2006 und natürlich der Klassiker: H. – I. Marrou, Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum, hrsg. von R. Harder. Freiburg/München 1957). Als Ziel seiner Untersuchung gibt K. an, „die jeweiligen literarischen Motive und Formen der Werbung für die Beredsamkeit und für den Unterricht in der Rhetorik in der römischen Literatur zu beschreiben“ (12). Im ersten Kapitel erläutert K. den Begriff Protreptik, geht auf Motive und ihre Entstehung ein (13-36). Im Vordergrund der „sachlichen Grundlagen“ stehen griechische Autoren, vor allem Isokrates; die Vertreter der griechischen Rhetorik setzten sich mit den Sophisten und den Philosophen auseinander und bildeten protreptische Motive und Formen heraus (12). Wie am Ende aller Kapitel bietet K. auch hier eine Zusammenfassung (36). Auf der Basis dieser Analysen beschreibt K. im zweiten Kapitel (37-47) die Wege der Protreptik für die Rhetorik von Athen nach Rom. Dabei spielen Cato der Ältere und Cicero, aber auch Seneca der Ältere eine entscheidende Rolle. Der Verfasser widmet Cato dem Älteren ein eigenes Kapitel (Kapitel drei) und präsentiert ihn als Redner und Vorbild (48-62). Dann folgt das zentrale vierte Kapitel: Cicero (63-195). Im fünften Kapitel untersucht K. die Bedeutung Senecas des Älteren im Rahmen seiner Fragestellung (196-218). Im sechsten Kapitel stellt K. die erarbeiteten Ergebnisse vor (219-224), im siebten Kapitel finden die Leserinnen und Leser ein umfangreiches Literaturverzeichnis (225-235). Das Register mit dem Index locorum und den Stichwörtern bildet den Abschluss des Buches (237-249).
Das erste Kapitel beginnt K. mit einer Definition des zentralen Begriffs seines Buches: „Unter Protreptik versteht man in der modernen Forschung die Werbung für einen bestimmten Unterricht, für einen bestimmten Lehrer und um einen bestimmten Schüler“ (13). Eine solche Werbung geht einher mit verschiedenen protreptischen Motiven, vor allem mit dem „Motiv der Gabe, dem Lob der Redekunst, der Aufforderung zu Anstrengung und Übung, der Warnung vor dem Scheitern und dem Versprechen von Ruhm“ (220). Abgegrenzt wird die Protreptik von der Paränese, die verstanden werden kann als „die Aufforderung und Ermahnung, sich an bestimmte Regeln für die richtige Gestaltung des Lebens bzw. eines Lebensbereiches zu halten, und zugleich die Präsentation wichtiger Regeln“ (18). Als Paradebeispiele für paränetische Reden können Isokrates‘ Reden An Nikokles (Isoc. 2) und Nikokles oder An die Kyprier (Isoc. 3) genannt werden (18). Auf der Grundlage dieser Begriffsbestimmungen ist es K. möglich, systematisch seine Themenbereiche durchzuarbeiten.
Im zweiten Kapitel legt K. sein vertieftes Verständnis von dem vor, was er mit seiner Publikation untersuchen möchte, nämlich die Protreptik für die Rhetorik in Rom von den Anfängen bis zum Älteren Seneca.
Der erste römische Protagonist steht im dritten Kapitel im Vordergrund: Cato der Ältere. K. wählt dessen Werke aus zwei Gründen für seine Studie aus; einerseits könnte er als „Vorbild und Lehrer der Beredsamkeit“ gelten, andererseits wendet er sich an seinen Sohn mit dem deutlichen Ziel, ihn „zu erziehen und zu fördern“ (48). Damit steht er – wie auch Cicero und Seneca – in einem persönlichen Verhältnis zu einer ihm nahestehenden männlichen Person und setzt sich für den Erwerb rhetorischer Bildung ein. Hierbei rezipiert er bestimmte Schemata, die er direkt oder indirekt von dem griechischen Redelehrer Isokrates und dessen Nachfolgern entlehnt hat. In den folgenden Unterabschnitten analysiert K. näher das Bild Catos als Redner und Vorbild (49-51). Während es Cicero vergönnt war ungefähr 150 Reden Catos zu lesen (Brutus 65), können heutige Forscher nur um die 250 kleinere Fragmente aus 79 Reden studieren (49, Anm. 6). Der augusteische Historiker Livius bezeichnete Cato als eloquentissimus (Liv. 39, 40,4-8), demgegenüber entschied sich Nepos in seiner Kurzbiographie für eine andere Beurteilung: probabilis orator (Nep. Cat., 3,2). Quintilian lobt in seiner berühmten Institutio oratoria Cato als in dicendo praestantissimus (Quint. inst. 12, 3, 9 und 2, 5, 21), warnt aber ausdrücklich davor, „sich die Schroffheit Catos und der Gracchen zum Vorbild zu nehmen“ (49). Erwiesen ist, dass Cato sich intensiv mit der griechischen Literatur befasst hat – ein Faktum, das lange bestritten wurde. Dietmar Kienast hat in seiner bahnbrechenden Dissertation (Cato der Zensor. Seine Persönlichkeit und seine Zeit. Mit einem kritisch durchgesehenen Neuabdruck der Redefragmente Catos. Quelle und Meyer. Heidelberg 1954) dieses Vorurteil widerlegt, die bis dahin sehr einseitige Sichtweise zurechtgerückt und weitere Vorurteile über diesen römischen Feldherrn, Schriftsteller und Staatsmann relativiert. Dieses Publikation lässt K. leider unberücksichtigt, ebenso wie eine weitere sehr lesenswerte Studie von Michael von Albrecht: „Der Anfang der literarischen Prosa: M. Porcius Cato (234 – 149 v. Chr.)“ (in: Ders., Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius. Lothar Striehm Verlag: Heidelberg 1971, 15-50). Darin interpretiert der Autor einfühlsam und subtil die Vorrede zum Werke Catos: De agricultura, die Rede im Senat für die Rhodier (167 v. Chr.) sowie einen Textabschnitt über Cato, in dem dieser mit Leonidas verglichen wird (M. von Albrecht, a.a.O., 38-50). Ansonsten hat K. auf wichtige Forschungsergebnisse zurückgegriffen. Auch der griechische Schriftsteller Plutarch hat sich mit Catos Leben und Werk befasst und ihn als römischen Demosthenes bezeichnet (Plut. Cat. Ma. 4, 1-2). In diesem Zusammenhang verwendet der in Chaironeia geborene Historiograph das Substantiv δεινότης und beschreibt damit „eine überragende Redegewalt und die Fähigkeit, sie richtig und angemessen zu gebrauchen“ (50). Insgesamt kommt K. zu der Erkenntnis, dass Catos Leistung protreptisch genannt werden kann, denn er hat bei den jungen Römern Erfolg mit seinen Reden und regt sie an, ihn nachzuahmen und unter einander in Wettstreit zu treten (51). In einem weiteren Unterabschnitt erläutert K. das Verhältnis von Cato zu Karneades (52-55), um sich dann zwei Schriften zuzuwenden, die dieser an seinen Sohn gerichtet hat (Ad filium; Epistula ad M. filium, 55-61). K. geht umsichtig mit der Quellenlage um, denn beide Schriften sind nur fragmentarisch überliefert; so gibt es für die erst genannte Schrift nur 16 Fragmente (55), die sich in den Werken verschiedener Autoren finden lassen. K. arbeitet heraus, dass Cato gewissermaßen in Konkurrenz zu Karneades tritt und Motive und Strukturen der Protreptik aufgreift (62). Cato wendet sich an seinen Sohn (wahrscheinlich ist der älteste Sohn gemeint: M. Porcius Cato Licinianus, 58), aber auch an eine breitere Öffentlichkeit und initiiert damit eine Haltung, die ihre Fortsetzung bei Cicero und Seneca dem Älteren findet.
Im vierten und umfangreichsten Kapitel über Cicero rückt K. verschiedene Schriften des größten römischen Redners in den Fokus (verschiedene Briefe, das Commentariolum petitionis, De oratore, und De officiis (63-195)). Aus Platzgründen möchte ich in gebotener Kürze zunächst auf K.‘ Ausführungen zur Schrift De oratore, dann zu denen zu De officiis eingehen. Zur ersten Abhandlung stellt K. fest, dass es sich hierbei nicht um eine protreptische Schrift handelt, sondern um eine solche, die aber „eine große Vielfalt von Elementen eindeutig protreptischer Natur“ zeigt (140). K. belegt seine Ergebnisse mit den Hinweisen darauf, dass die drei Bücher eine immense Größe des Stoffes aufweisen (maius-Motiv); des Weiteren seien die Adressaten nicht nur sein Bruder Quintus, sondern vor allem jüngere Schüler, „die eine andere und bessere Ausbildung als die, die von der konventionellen Rhetorik angeboten werde, verdienten“ (141). K. registriert einen protreptischen Rahmen, eingeleitet von der cohortatio des Crassus am Beginn der Schrift (de orat. 1, 30), beendet mit dem Schlussgespräch (de orat. 3, 230), wobei den Adepten nahegelegt wird, alle Kräfte anzuspannen und zu verhindern, dass der junge Redner Hortensius sie in den Schatten stellt (141). Die Besonderheit dieser Schrift liegt darin, dass die Schüler eine jeweils unterschiedliche Entscheidung treffen, denn Sulpicius favorisiert den „normalen Weg“, Cotta hingegen votiert für die Philosophie der Akademie (142). K. sieht in De oratore eine Werbung für Ciceros „Konzept der Aussöhnung von Rhetorik und Philosophie“ (142).
Aus der Perspektive K.‘s ist die literarische Form des Traktats De officiis einfacher als die im Falle von De oratore (159). In der erst genannten Schrift hat Cicero jedes der drei Bücher mit einem persönlichen Vorwort eingeleitet und lässt das Werk mit einem Epilog am Ende ausklingen (159). In diesen Rahmenabschnitten argumentiert Cicero in einer explizit protreptischen Art und Weise, während man in den verbleibenden Textstellen eine paränetische Strategie erkennen kann; K. sieht Bezüge zwischen der Struktur von De officiis mit der Rede des Isokrates An Nikokles (or.2), in dessen Rahmenteil der griechische Rhetoriker Werbung für sein Fach betreibt, während der Haupttext Empfehlungen allgemeiner Art vor allem für Politiker bzw. Herrscher aufweist (180). Der römische Redner hat bekanntlich De officiis in genauer Kenntnis der Vorlage des Panaitios verfasst, der sich zwar an junge Personen richtet, aber ausdrücklich keine Werbeschrift konzipieren wollte, weder für die Philosophie noch für die Rhetorik (194). Ciceros Spätschrift De officiis trägt demnach einen gewissen Widerspruch in sich, der nur unter der Annahme auflösbar erscheint, „dass der Rahmen mit seiner Ermunterung zu rhetorischen Studien in gewisser Weise über dem engen Inhalt der Bücher steht, ohne diese aufzuheben oder einzuschränken. So kann Cicero zugleich den möglichen Konflikt von De officiis mit seinen anderen philosophischen Schriften entschärfen“ (194/195).
Das fünfte Kapitel widmet K. dem römischen Rhetor und Schriftsteller L. Annaeus Seneca, genannt der Ältere – im Gegensatz zu seinem Sohn, Seneca der Jüngere. Zunächst untersucht K. die Schrift Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores (ca. 37. n. Chr.) auf seine Fragestellung. Darin finden sich Auszüge von Deklamationen, von Anekdoten und literarkritischen Beiträgen (196). Ebenso wie bereits Cato und Cicero sind die Adressaten Senecas die erwachsenen Söhne. Ausdrücklich beruft sich Seneca nicht auf Cicero, zitiert hingegen im Prooemium der ersten Controversia aus Catos Schrift Libri ad Marcum filium (197). Die Adressaten der Controversiae sind keine Schüler oder Studenten der Rhetorik mehr. Sie befinden sich am Anfang ihrer Karriere als Anwälte oder Politiker. K. bietet Informationen über die drei Söhne Senecas: L. Iunius Annaeus Novatus, L. Annaeus Seneca und Annaeus Mela. Auch wenn sich Seneca der Jüngere von der Philosophie begeistern lässt, bedeutet dies aber keine Abwendung von der Rhetorik. Es lässt sich bei Seneca dem Älteren auch keine Konkurrenz zwischen Rhetorik und Philosophie konstatieren. K. prüft umsichtig, wieweit Seneca protreptische Motive verwendet. Als erstes nennt er das Motiv des audire velle, d. h. die Söhne zeigen großes Interesse, die Sententiae der Deklamationen zu hören (200). Auch das maius-Motiv erkennt K. im Werk Senecas, da dieser die Beredsamkeit als hochheilig bezeichnet (sacerrima eloquentia, 203). Ein zentrales pädagogisches Anliegen Senecas ist darin zu sehen zu erreichen, dass sich die Söhne ein Urteil bilden können über die Disziplinen, in denen sie unterrichtet werden (iudicium). Wichtig ist ihm, dass seine Söhne nicht nur ein einziges Vorbild nachahmen, sondern mehrere Ideale anerkennen sollen (Sen. contr. 1, pr. 6, in Anlehnung an Ciceros gleichartige Auffassung (Cic. inv. 2, 1-5): facitis autem, iuvenes mei, rem necessariam et utilem quod non contenti exemplis saeculi vestri priores quoque vultis cognosere; primum quia, quo plura exempla inspecta sunt, plus in eloquentiam proficitur, non est unus, quamvis praecipuus sit, imitandus, quia numquam par fit imitator auctori). Die Rhetorenschulen zur Zeit Senecas bieten eine Ausbildung in verschiedenen Fachgebieten, etwa in der Beredsamkeit (211-212), in der Philosophie (212-213), in der Geschichtsschreibung (214-215) und in der Poesie (216-217). Senecas Ausführungen können als Werbung begriffen werden, obwohl er für keines der angegebenen Disziplinen eine Präferenz zeigt und den Adressaten eine freie Entscheidung einräumt (218).
Insgesamt legt K. mit seiner Studie ein wertvolles Buch vor, das die Forschung entscheidend voranbringt. Dabei verfolgt er stringent seine anvisierten Ziele, legt ein wohlüberlegtes und gut nachvollziehbares Analyseraster vor, verwendet wichtige Forschungsliteratur zum Thema (vgl. aber die Bemerkungen zu Cato), bedient sich eines flüssigen Stils und verlegt lateinische Zitate oft in die Anmerkungen, um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen.
Rezensent: Dietmar Schmitz
Tief betroffen mussten wir erfahren, dass der Verfasser der hier vorgestellten Neuerscheinung des Monats Februar 2024 in eben diesem Monat verstorben ist.

Januar 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Dominic Bärsch, Mundus ecce nutat et labitur. Weltuntergangskonzepte in der griechischen und lateinischen Literatur, Göttingen (Vandenhoeck & Rupprecht) 2023, Hypomnemata 218. ISBN 978-3-525-30221-7
Ein Jahreswechsel ist Anlass, über den Wandel der Zeitläufte und damit letztlich auch ihr Ende nachzudenken – so möge es verstanden werden, wenn hier eine Studie über antike Weltuntergangskonzepte zur Vorstellung gelangt. Zunächst wirft der Verfasser, unabdingbar in einer Dissertation, aber doch gedanklich anregend, die grundsätzlichen Fragen auf, wie Vorstellungen eines Weltuntergangs überhaupt begründet, unter Rückgriff auf Metaphern formuliert und vermittelt werden. Der inhaltlich orientierte Durchgang ist dann recht pragmatisch, tendenziell chronologisch strukturiert und beginnt natürlich im griechischen Denken: Zunächst ist da das Konzept der großen Flut, zweitens über Vergehen und Wiedererstehen der Welt. Dann wechselt die Perspektive auf Rom – hier nun eher historisch: Der Verfasser stellt dar, wie sich in der ausgehenden Republik Lukrez und Cicero das Ende der Welt vorstellen. Das mit 90 Seiten ausführlichste Einzelkapitel gilt der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Literatur: Hier werden Ewigkeitskonzepte neben Flut, Weltenbrand und Chaos gestellt. Ein letztes Kapitel gilt der jüdisch-christlichen Literatur: Neben dem Jüngsten Tag kommen auch hier Flut, Weltenbrand und die Vorstellung vom Altern der Welt zum Tragen. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Studie, nicht um ein Sachbuch, das in erster Linie sein Publikum in den Bann schlagen soll. Und doch ist der mutig weite und dabei geglückte Umgriff – was das Thema, aber auch, was das Textcorpus angeht, das von Homer bis in die jüdisch-christliche (Spät-)Antike reicht. Es zeigt sich: So unterschiedlich Kontext (Mythologie, Naturphilosophie, Dichtung, jüdisch-christliche Apokalyptik usw.) und Komplexität in der Ausarbeitung der vorgestellten Weltuntergangskonzepte auch sind (dieser Faktoren ist sich der Verfasser wohltuend bewusst) – beeindruckend klar werden Bedeutung, Präsenz und Facettenreichtum der Vorstellung von einer globalen Katastrophe durch Feuer oder durch Flut in der Antike. – Das regt am Ende eines Jahres, das von Hitze- und Dürrerekorden geprägt war, und an einem Jahreswechsel mit weitreichenden Überflutungen durchaus zum Nachdenken an: Natürlich weiß die Antike nichts von einem anthropogenen Klimawandel und erhebt keine empirisch-naturwissenschaftlichen Daten. Aber sie reflektiert die existentielle Gefährdung durch Feuer und Flut und berücksichtigt sie nach den Maßgaben ihres Denkens in ihren mythologischen, philosophischen und literarischen Weltkonzepten. Welcher Impuls kann davon für eine Gegenwart ausgehen, der nach den Maßgaben ihres Denkens die Möglichkeit empirisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis und der politisch-ökonomischen Umsetzung zu Gebote stehen?
Stefan Freund

Dezember 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Susan Stokes-Chapman, Das Erbe der Pandora Blake, aus dem britischen Englisch von Elisabeth Maler, München 2023, ISBN 978-3423283496, € 23,00
bzw. die gelesene Version: Susan Stokes-Chapman, Pandora, London 2023, ISBN 978-1529114744, 11,50 €
Wir befinden uns in London im Jahr 1799: Die 21-jährige (Pan)Dora Blake führt mit ihrem Onkel Hezekiah das Antiquitätengeschäft ihrer verstorbenen Eltern, die sich ihrer Zeit insbesondere mit (früh)griechischen Gütern beschäftigten. Leider hat Hezekiah das Geschäft heruntergewirtschaftet, weswegen Dora sich erträumt, als Goldschmiedin eigenständig leben zu können, um ihrem Vormund zu entgehen. Eines Tages, als ebenjenem ein mysteriöser griechischer Pithos geliefert wird, den er sofort in die ihr verschlossenen Kellerräume bringen lässt, muss Dora feststellen, dass die Vergangenheit dunklere Geheimnisse birgt als erwartet. Um ihre Neugier zu stillen und ihrem Onkel auf die Schliche zu kommen, verbündet sich Dora mit dem Buchbinder und angehenden Archäologen Edward, woraus sich ein geheimnisumwobenes Abenteuer entwickelt.
Unbemerkt wird der Lesende in den Bann gezogen, während die Geschichte, die aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, langsam aber sicher an Fahrt aufnimmt. Auf 448 Seiten entfaltet sich in elegantem und kunstvollem Schreibstil, der das Herz eines Philologen zum Höherschlagen bringt, die historische Fiktion rund um das Georgianische Zeitalter, das mit Magie und Mythos der Antike verstrickt wird. Während sich die Romanze und ein Teil der Geschichte zwar vorhersehbar entwickeln, liegt der Reiz des Buches im Detail: Das Lesen und es zu genießen, ist das Ziel. Es zaubert einem unwillkürlich ein Lächeln auf die Lippen, wenn die Charaktere Namen wie Horatio oder Hermes tragen, wenn das griechische Alphabet im Kopf aufgesagt wird, um sich zu beruhigen, wenn ganz nebenbei das Wissen rund um weißgrundige Vasenmalerei aufgefrischt wird oder wenn der Übersetzungsfehler „eines niederländischen Philosophen“ (von πίθος = Krug zu πυξίς = Büchse) eine wichtige Rolle für die Aufklärung einiger Rätsel spielt.
Es handelt sich also bei diesem Werk nicht um eine Reinterpretation, wie es sie im Moment vermehrt zu entdecken gibt, sondern um eine Weitererzählung des altbekannten Mythos. Interessant ist dieser gelungene Debüt-Roman also für alle, die historische Fiktion aus der Zeit Napoleons, verwoben mit antikem Mythos, begeistern kann.
Anna Stöcker, Bergische Universität Wuppertal
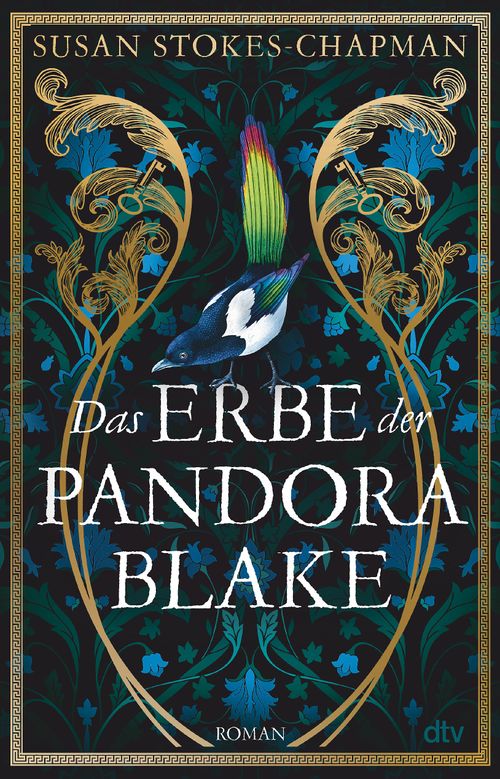
November 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Jehne, M., (2022), Ausgewählte Schriften zur römischen Republik. Hrsg. von B. Linke, Chr. Lundgreen, R. Pfeilschifter und C. Tiersch. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 373 S. 72. EUR (ISBN 978-3-515-13298-5).
Es ist eine schöne Geste, wenn ehemalige Schülerinnen/Schüler für ihre akademische Lehrerin/ihren akademischen Lehrer eine Festschrift oder ein Buch mit ausgewählten Aufsätzen der/des zu Ehrenden publizieren. Im vorliegenden Fall haben sich gleich vier Forscherinnen/Forscher der arbeitsreichen Mühe unterzogen, zwölf Aufsätze von Martin Jehne herauszusuchen und zu veröffentlichen, die er im Zeitraum von 1993 und 2004 verfasst hat. Alle vier Forscher und Forscherinnen haben am Lehrstuhl von Martin Jehne an der Universität Dresden gelehrt und geforscht. Sie haben sich für vier Rubriken entschieden, wobei die Aufsätze nach Inhalten angeordnet sind, nicht nach ihrem jeweiligen Erscheinungsjahr. Die Rubriken sind: Das Volk und seine Versammlungen (11-85), Die Elite, das Volk und ihre Kommunikation (89-171), Rom, Italien und das Imperium (175-265) und: Von der Republik zum Prinzipat (269-352). Daran schließen sich eine Liste mit den Erstveröffentlichungen (353-354), dem Stellenregister (355-367) und dem Personenregister (369-373) an. Das Buch weist eine Besonderheit auf, die für die Leser und Leserinnen von großem Nutzen ist: Zu jeder Rubrik haben die jeweiligen Bearbeiterinnen/Bearbeiter einen Kommentar verfasst, mit dem sie laut Vorwort „keine Würdigung des gesamten wissenschaftlichen Schaffens von Jehne anstreben. Das hat vor kurzem schon Hartmut Leppin in der Laudatio des 2019 verliehenen Karl-Christ-Preises getan“ (8). Sie haben sich vielmehr jeweils für einen Ausschnitt aus dem Werk und dem Wirken von Jehne entschieden und sich zum Ziel gesetzt, „Jehnes grundlegende Erkenntnisse zur politischen Kultur der römischen Republik und seine Meisterschaft“ zu kommentieren, „aus kleinen Episoden große Strukturen neu zu denken“ (8).
Für eine andere Variante, die auch lobenswert ist, haben sich die Herausgeber und Herausgeberinnen der „Entretiens sur l’Antiquité classique“, publiziert von der Fondation Hardt in Vandoeuvres/Schweiz, entschieden. Dabei wird nach jedem Aufsatz/Vortrag die sich daran anschließende Diskussion abgedruckt. Zuletzt ist der Band 67 erschienen, hrsg. von V. Fromentin, Écrire l’histoire de son temps, de Thucydide à Ammien Marcellin (2021), Vandoeuvres 2022.
Natürlich können im Rahmen dieser Buchvorstellung nicht alle zwölf Aufsätze vorgestellt werden, ich möchte aber zumindest alle Titel anführen und auf einige näher eingehen. Ich beginne mit dem ersten Block, für den Bernhard Linke, Professor für Alte Geschichte an der Universität Bochum, drei Aufsätze ausgesucht und anschließend kommentiert hat, die die Rolle des Volkes in den Versammlungen thematisieren. Der Titel des ersten Aufsatzes lautet: Geheime Abstimmung und Bindungswesen in der Römischen Republik (11-26). Cicero beschwert sich in mehreren Schriften über die Einführung der geheimen Abstimmung in den römischen Volksversammlungen (z. B. Cic. leg. 3,34). Jahrhundertelang war es in der Zeit der römischen Republik üblich, dass die Abstimmung offen durchgeführt wurde. Ab 139 v. Chr. wurde schrittweise in den einzelnen Gremien die geheime Abstimmung eingeführt. Aus heutiger Sicht ist dies selbstverständlich. Die Forschung hat sich lange an der Kritik Ciceros orientiert, aber es gab auch andere Stimmen; Jehne hat sich dazu dezidiert geäußert und Verständnis gezeigt. Schaut man auf das Verhältnis zwischen patronus und cliens, so konnte bei einem offenen Abstimmungsverfahren der cliens sein Eintreten für den patronus transparent darlegen und zeigen, wen er unterstützte. Als aber das römische Reich immer komplexer wurde, unterhielten viele Adlige verschiedene Beziehungen, so dass es nicht sinnvoll war, die Abstimmung weiter offen durchzuführen. Jehne bringt es auf den Punkt: „Dieser Überlagerungsprozess hatte aber zur Folge, dass es immer häufiger vorgekommen sein muss, dass Römer Bindungen zu Exponenten gegenläufiger Entscheidungsempfehlungen unterhielten. Besonders virulent wurde dieses Problem zweifellos bei den Wahlen.“ (20) Jehne erläutert das Problem der veränderten Lage der Wahlen zum Konsulat, bei denen im zweiten Jahrhundert v. Chr. teilweise sieben Kandidaten miteinander konkurrierten (21). Durch die Mehrfachbindung an Angehörige der Oberschicht konnte es für manche Wähler sehr schwierig werden, ihre Loyalität zu bekunden. „Die Betroffenen gerieten in Loyalitätskonflikte, bei denen die Entscheidung für zwei Kandidaten einen anderen verprellte“ (22). Jehne belegt seine Analysen mit dem jeweils aktuellen Forschungsstand und unter Rückgriff auf die antiken Quellen. In klarer Diktion beschreibt er seinen Argumentationsgang, der für die Leserinnen/Leser gut nachvollziehbar ist. Im Kommentarteil ordnet B. Linke Jehnes Ausführungen in einen größeren Zusammenhang, erläutert die methodischen Zugriffe und die Arbeitsweise Jehnes und berücksichtigt auch die inzwischen publizierten Forschungsergebnisse.
Ein Aspekt, der bereits im ersten Aufsatz kurz angesprochen wurde, steht im zweiten Beitrag im Vordergrund: Die Beeinflussung von Entscheidungen durch „Bestechung“: Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik“ 27-52). Jehne stellt fest, dass das Phänomen der Bestechung (ambitus) spätestens seit dem zweiten Jahrhundert verstärkt auftrat, aber trotz gesetzlicher Vorgaben weiterhin Bestand hatte (28).
Der Titel des dritten Aufsatzes lautet: Das Volk als Institution und diskursive Bezugsgröße in der römischen Republik“ (53-75). Jehne untersucht zunächst die verschiedenen Bezeichnungen des Volkes (plebs, populus, res publica) und ihre „unterschiedliche Konnotationen im römischen Kontext“, danach die „institutionelle Rolle des Volkes, also letztlich die Volksversammlungen“, und die „Partizipationsfrequenz und -breite der Bürgerschaft und ihren direkten Einfluss auf die relevanten Entscheidungen“ (53). Er stellt auch die Frage, wer das Volk eigentlich war (62-65). Jehne geht im Abschnitt über den Volksdiskurs auch auf den wichtigen Wertbegriff auctoritas ein (65-69), um am Ende seines Beitrags ein instruktives Resümee zu bieten (69-72). Wer sich intensiver mit der Thematik befassen möchte, kann auf die umfangreichen Literaturangaben zurückgreifen (72-75). Im Kommentarteil werden noch einmal wichtige Aspekte aufgegriffen und erläutert, darüber hinaus erfahren die Leserinnen und Leser einige Details über Jehnes Arbeitsweise. Linke verweist zum Beispiel auf die große Bedeutung eines Sonderforschungsbereich der Uni Dresden, die Jehne maßgeblich mitgestaltet hat: „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ (84). Wenn Jehne etwa nachvollziehen kann, dass ab 139 v. Chr. die geheime Wahl der Amtsträger vonstattenging, könnte man dies falsch verstehen; aber, Jehne ist überzeugter Demokrat, daher schreibt Linke mit voller Berechtigung: „Sein (Rez.; also Jehnes) Denken geht immer vom Bürger aus, der die Pflicht hat, sich in die Gesellschaft aktiv einzubringen, statt in akzeptierender Passivität zu verharren. In seiner eigenen Gegenwart tritt Martin Jehne vehement für seine Vision eines engagierten Bürgers ein, der sich nicht von politischen Inszenierungen blenden lässt, sondern durch eine aktive Rolle in der Gesellschaft seiner ‚bürgerlichen‘ Verantwortung gerecht wird“ (84). Wie wichtig ein solches Engagement sein kann zeigt aktuell die Diskussion über die Rolle einzelner Parteien in der Bundesrepublik Deutschland.
Im zweiten Block, für den Christoph Lundgreen verantwortlich ist, geht es um Die Elite, das Volk und ihre Kommunikation (89-171). Im Mittelpunkt des ersten Aufsatzes stehen die Begriffe „Jovialität und Freiheit“; der Untertitel lautet: Zur Institutionalität der Beziehungen zwischen Ober- und Unterschicht in der römischen Republik (89-112). Jehne beginnt seinen Aufsatz, der aus dem Jahr 2000 datiert, mit der Feststellung, dass die Geschichte der römischen Republik „eigentlich eine Erfolgsgeschichte“ ist. „In den knapp 500 Jahren dieser Organisationsweise wurde der gesamte Mittelmeerraum erobert, und territoriale Expansion wurde in der Antike ganz selbstverständlich positiv gesehen. Dass der Schlüssel für diese Erfolge in der römischen Verfassung zu suchen ist, hat schon Polybios mit Nachdruck vertreten“ (89). In der Forschung wurde mehrfach die Frage gestellt, warum das Volk über einen sehr langen Zeitraum den Adligen Folge leistete. Jehne hat einen Begriff eingeführt, der erklären kann, auf welche Weise der Adel mit dem Volk umgegangen ist: Jovialität ist der Schlüsselbegriff (96). Darunter versteht er „eine Form des Umgangs zwischen sozial Ungleichen (…), bei der der Mächtigere darauf verzichtet, seine Dominanz auszuspielen, und sich stattdessen so gibt, als befinde er sich auf der gleichen Stufe wie sein Gegenüber. Dabei wissen beide Seiten um die soziale Asymmetrie in der Beziehung. Die Wirkung besteht nicht darin, dieses Wissen generell aufzuheben, sondern darin, die aktuelle Präsenz dieses Wissens in der jeweiligen konkreten Situation zu vermindern“ (96/97). Zum besseren Verständnis erläutert Jehne den Bedeutungsbereich des Adjektivs jovialis (97). Eng damit verbunden sind zwei weitere Begriffe, nämlich comitas und civilitas (97), deren Bedeutungsnuancen ebenfalls näher vorgestellt werden (97). Obwohl der Begriff Jovialität ein moderner ist, entscheidet sich Jehne für ihn. Er exemplifiziert dies am Beispiel der morgendlichen salutatio, wenn ein römischer Adliger Angehörige der einfachen Bevölkerung empfing; dabei sollte er sich „jovial“ verhalten, so wie es im Deutschen Universalwörterbuch der Dudenredaktion formuliert wird: „im Umgang mit niedriger Stehenden betont wohlwollend“ mit dem Zusatz qualifiziert: „nur in Bezug auf Männer“ (98, Duden S. 791). Ausgangspunkt für Jehnes Überlegungen war eine Episode, die bei Livius nachzulesen ist (Liv. 4,49,7-50,5). Jehne erläutert das Fehlverhalten von zwei Amtsträgern und illustriert damit, dass der moderne Begriff „Jovialität“ sehr passend ist, um Situationen am Ende der römischen Republik genauer einordnen zu können. Er vergisst auch nicht darauf hinzuweisen, dass „die Bedeutung des Jovialitätsgestus“ nicht nur in der römischen Republik gefragt war, sondern auch im Prinzipat des Augustus eine wichtige Rolle spielte (112); für Jehne war dieser Herrscher „der konkurrenzlose Meister in dieser Kunst“ (112). Nach Sueton (Aug. 99,1) soll Augustus kurz vor seinem Tod zu seinen Freunden gesagt haben:
„Wenn es euch gut gefallen hat, gewährt Applaus
Und schickt mit Freude uns voraus.“ (112)
Der Titel des zweiten Aufsatzes lautet: Integrationsrituale in der römischen Republik. Zur einbindenden Wirkung der Volksversammlungen (113-134). Jehne konzentriert sich auf die Volksversammlungen, wobei drei Typen unterschieden werden: comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa (114). Hier wie auch sonst erklärt er die von ihm benutzten Begriffe, erläutert sein methodisches Vorgehen und setzt sich mit dem aktuellen Forschungsstand auseinander. Das umfangreiche Literaturverzeichnis zeigt, wie intensiv sich Jehne mit den Thesen anderer Forscher befasst und sie durchdenkt, bevor er zu einem eigenen Ergebnis gelangt.
Auch der dritte Aufsatz zeigt, wie sehr bei Jehnes Beiträgen alles zusammenhängt: Scaptius oder der kleine Mann in der großen Republik. Zur kommunikativen Struktur der contiones in der römischen Republik (135-162). Hier geht er von einer Stelle im Werk des Livius aus (Liv. 3, 71,1-8), um seine Sicht der Dinge zu entfalten. Der greise P. Scaptius, ein 83jähriger Mann aus der plebs, hat sein Leben lang an Sitzungen teilgenommen und in einer das Wort ergreifen wollen, ein sehr ungewöhnlicher Wunsch. Die Konsuln lehnten zunächst ab, aber aufgrund des Eingreifens der Volkstribunen wurde dem älteren Herrn das Wort erteilt (135). Jehne analysiert diese Episode genau. Allerdings gab es ein großes Problem bei diesem Vorgang: Auctoritas kann dem Volk (populus) zwar zugesprochen werden, aber nur dem Kollektiv, nicht Individuen (Cic. Imp. Cn. Pomp. 63). Jehne urteilt folgendermaßen: „Der auctor cupiditatis Scaptius ist also eine Pervertierung des auctoritas-Gefüges, denn er verfügt nicht über die normalen Grundlagen der auctoritas – vornehme Herkunft und erfolgreiche Karriere, die sich an Ämtern festmacht - , sondern ist eben ein contionalis senex de plebe“ (146). Die Scaptius-Geschichte zeigt, dass die Forschung der letzten 30 Jahre zu Recht zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangt ist. Aus der Sicht Jehnes ist in dieser Episode „das Verhältnis von politischer Führungsschicht und einfachem Volk auf den Ebenen der rechtlichen Festlegungen wie der soziopolitischen Praxis thematisiert“ (147). Jehne vertritt die Auffassung, dass die Scaptius-Episode eine Warnung darstellt. Weiterhin erklärt er: „Es fehlt ihnen (Rez.: gemeint sind „Versammlungsroutiniers“ wie Scaptius) der Wertehaushalt, der zur Lenkung der Staatsgeschicke nötig ist, sie kennen nur Gier und nackte materielle Interessen und stoßen dann, wenn sie sich als Redner versuchen, bei den Zuhörern auf Komplizenschaft, da diese ja dieselben moralischen Ausstattungsdefizite aufweisen. (…) Der kleine Mann Scaptius bewegt sich also in der großen Politik wie der Elephant im Porzellanladen, wobei er sich dabei auch noch besonders schlau vorkommt“ (157). Christoph Lundgreen, Jehnes Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Alte Geschichte in Dresden, erkennt im Kommentarteil, dass die von ihm ausgewählten Aufsätze trotz verschiedener Themen eng zusammengehören (168). Aus der Sicht Lundgreens hält sein akademischer Lehrer „die Stabilität und lange Dauer der römischen Republik“ für „erklärungsbedürftig“ (168). Im Zentrum der Forschungstätigkeit Jehnes stehen die Kommunikationsstrukturen, so Lundgreen (169).
Für den dritten Block mit verschiedenen Aufsätzen ist Claudia Thiersch verantwortlich, Lehrstuhlinhaberin für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat für die drei von ihr ausgesuchten Aufsätze folgenden Titel gewählt: Rom, Italien und das Imperium. Die Forscher und Forscherinnen haben bei der Analyse der ausgehenden römischen Republik in den letzten Jahren ihren Blick auf Roms Vernetzungen mit Italien gelenkt. Thiersch schreibt dazu: „Dies erlaubt nicht nur die präzisere Frage nach den Ursachen für die militärische Dynamik Roms, sondern auch nach den Mechanismen politischer Integration bzw. Nichtintegration und ermöglicht dann, die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherien in ihrer kulturellen Vielfalt neu zu justieren“ (251). Thiersch geht auf die Forschungsergebnisse einiger Althistoriker ein, ordnet dann Jehnes Beiträge in den aktuellen Diskurs ein und stellt die Impulse vor, die von Jehne ausgegangen sind. Wichtig ist dabei auch der Ausblick auf den frühen Prinzipat des Augustus, um so die Entwicklung der letzten Jahre der ausgehenden römischen Republik verstehen zu können. Die Titel der drei Aufsätze, die zum Teil 2021 erstmals publiziert wurden, lauten: Römer, Latiner und Bundesgenossen im Krieg. Zu Formen und Ausmaß der Integration in der republikanischen Armee (175-196); Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom (197-222); From Patronus to Pater. The Changing Role of Patronage in the Period of Transition from Pompey to Augustus (223-250). Auch wenn Römer, Latiner und Peregrine ein gemeinsames Heer bildeten, dienten die Soldaten dennoch nicht in „gemischten Einheiten“ (176). Die Latiner und andere Bundesgenossen waren jeweils in eigenen Kohorten und Alen tätig (176). Es ist dabei zwischen Armeeangehörigen der Oberschicht und den einfachen Soldaten streng zu differenzieren. „Während italische Oberschichtsangehörige innerhalb der Kavallerie oder als Truppenkommandeure fungierten und sich somit als Teil einer italisch-römischen Elite wahrnehmen konnten, kämpften italische Soldaten in regional gegliederten Kampfverbänden unter einheimischen Kommandeuren und hatten bestenfalls zufällig mit ihren römischen Mitsoldaten zu tun“ (252).
Augustus hat nachweislich aus den „Fehlern“ Caesars gelernt und seine Machtposition ausgebaut, indem er die sozialen Beziehungssysteme tiefgreifend transformierte, ohne dass das ursprüngliche Patronagegeflecht gänzlich aufgegeben wurde (259). Jehne versucht erfolgreich, die Gründe für die Transformationen der Beziehungen zwischen Rom und seinen italischen Verbündeten darzulegen. Wer sich noch genauer mit der Thematik befassen möchte kann auf die zahlreichen Publikationen zurückgreifen, die sich in den Literaturverzeichnissen am Ende der Aufsätze bzw. am Schluss des Kommentars finden.
Den vierten und letzten Block: Von der Republik zum Prinzipat hat Rene Pfeilschifter, Professor für Alte Geschichte an der Universität Würzburg, sorgfältig bearbeitet. Im ersten Aufsatz: Der Dictator und die Republik. Wurzeln, Formen und Perspektiven von Caesars Monarchie (269-293) geht Jehne von dem Hinweis aus, dass Caesars Streben nach der Monarchie nicht von Anfang an geplant war. Er gibt Antworten auf die Fragen, „warum Caesars Monarchie eigentlich die Gestalt annahm, die wir fassen können, warum Caesar sie, als sie ihm zugefallen war, nicht wieder aufgab, wenn er sie denn, wie ich dargelegt habe, mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht angestrebt hatte, und welche Perspektiven sein System eigentlich bot“ (274). Pfeilschifter beschreibt im Kommentarteil sehr klar, worum es Jehne in seinem Aufsatz ging, nachdem er einen kurzen Streifzug durch die Entwicklung der deutschsprachigen Althistorie vorgenommen hat (341ff.). Für Jehne war es danach entscheidend, dass Caesar in seiner Position als dictator unabhängig war bei „der Besetzung der regulären Obermagistrate“ und daher die Chance erhielt, die Wahlen persönlich zu leiten (343). Caesar benötigte Bewerber, die ihm absolut loyal gegenüber waren. Er hatte nach Jehnes Darlegungen nie die Absicht, wie sein Vorbild Sulla, von seinen Ämtern zurückzutreten. Vielmehr galt folgendes: „Seine präzedenzlosen Leistungen forderten eben präzedenzlose Auszeichnungen“ (343). In Jehnes Perspektive trat Caesar bereits in der Republik als Monarch auf, und zwar so, „dass er sich bei aller Geschicklichkeit in der Behandlung der anderen von seiner Grundlinie nicht abbringen ließ. Diese Fixierung auf das Ziel war nicht republikanisch. Die ungeheure Flexibilität in der Sache, die republikanische Politiker aufbrachten, findet sich bei ihm nicht, dagegen übertraf er seine Kollegen möglicherweise hinsichtlich der Flexibilität in den Formen“ (293).
Der zweite Aufsatz ist folgendermaßen überschrieben: Caesars Alternative(n). Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozess und Betriebsunfall (295-314), während Augustus im dritten Beitrag eindeutig im Fokus steht: Augustus in der Sänfte. Über die Invisibilisierung des Kaisers, seiner Macht und seiner Ohnmacht (315-339). Augustus hatte zwar eine faktische Alleinherrschaft kreiert, diese wollte er aber nicht in der Öffentlichkeit besonders betonen, sondern behielt weitgehend die traditionelle res publica bei. Auch wenn er die morgendliche salutatio nicht gänzlich abschaffen konnte, verengte er gleichwohl die Zugänge zu seiner Person, „um die Menge der verteilten Ressourcen und der erzeugten Enttäuschungen gleichermaßen in Grenzen zu halten“ (339). In einer geschlossenen Sänfte gelang es ihm, seine Präsenz in der Öffentlichkeit stark zu reduzieren und sich den zahlreichen Bittstellern weitgehend zu entziehen. Andererseits hatte er Offenheit propagiert. Hier entstand natürlich ein gewisses Dilemma. Aber, so beschreibt es Jehne am Ende seines Beitrags: „Insgesamt zählt es zu den außerordentlichen Leistungen des Augustus, diese Gratwanderung gemeistert zu haben, ohne in den Geruch der Arroganz und Abgehobenheit geraten zu sein“ (339). Alle Aufsätze datieren aus der Zeit von 1993 bis 2021. Aus der Sicht Pfeilschifters interessierte sich Jehne für Caesar schon deshalb, weil sonst kaum eine historische Person „so reiches Anschauungsmaterial für Möglichkeiten und Grenzen einer politischen Situation“ bietet (345).
Die Texte der zwölf Beiträge sind flüssig geschrieben, die Argumente gut nachvollziehbar, Ausgangspunkte sind oft kleine Episoden, der Blick des Forschers ist nicht nur auf die ausgehende römische Republik gerichtet, sondern er greift auch auf die Geschichte der früheren Jahrhunderte zurück und gewährt Ausblicke in die Zeit des frühen Prinzipats. Ältere Beiträge werden dadurch aktualisiert, dass sie von den vier Herausgeberinnen/Herausgebern kommentiert werden und neue Forschungsergebnisse eingearbeitet werden. Als Fazit ergibt sich, dass das Buch uneingeschränkt den Leserinnen und Lesern zu empfehlen ist, die sich mit der ausgehenden römischen Republik und dem Beginn der frühen Kaiserzeit unter Augustus beschäftigen wollen.

Rezensent: Dietmar Schmitz
Oktober 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Elodie Harper, Die Wölfe von Pompeji. Roman. Übersetzt aus dem Englischen von Martina Schwarz, München (Piper) 2023, ISBN 978-3-492-50662-5, 459 Seiten, € 20,00 (Englische Originalausgabe: The Wolf Den, London 2021)
Mit Pompeji assoziieren die meisten Menschen sicherlich den Vesuvausbruch im Jahr 79. Altertumswissenschaftlich Interessierten kommt daneben schnell die Graffitisammlung, wichtige Zeugnisse des damaligen Alltags, in den Sinn. Übersetzungen solcher Graffiti sind auch einzelnen der 44 Kapitel aus Elodie Harpers Roman „Die Wölfe von Pompeji“ vorangestellt. Harper studierte in Oxford englische Literatur und lateinische Poesie. Sie arbeitet als Journalistin, Autorin und derzeit als Reporterin bei ITV News Anglia. „The Wolf Den” gewann den Glass Bell Award 2022 und war im gleichen Jahr auf der Shortlist des British Book Awards.
Die Handlung setzt im Februar 74 in Pompeji ein. Die Protagonistin Amara ist eine Prostituierte des Bordells Wolfshöhle (lupa, -ae – Wölfin, Prostituierte). Gemeinsam mit fünf weiteren Frauen erlebt sie den schroffen Alltag von ärmlichen Sklav:innen in der kampanischen Stadt. Jedoch sucht Amara, bei der es sich um die aus Griechenland stammende Tochter eines Arztes handelt, scharfsinnig nach Möglichkeiten, ihre Freiheit zurückzuerlangen. Einen Wendepunkt bilden die Vinalia, im Zuge derer sich Amara als singende Leierspielerin präsentiert. Daraufhin wird sie auch für entsprechende Auftritte in den Häusern angesehener Bürger gebucht – ein Höhepunkt ist der Aufenthalt in der Villa des älteren Plinius. Im folgenden rasanten Wechsel zwischen dem Leben als Konkubine eines reichen Römers und dem Dasein als Gefährtin jedes Zahlungsfähigen gelingt der Protagonistin zuletzt der eigene Freikauf in einem emotional geladenen Finale, das sowohl von Gewinn als auch von Verlust geprägt ist.
Harper beschönigt die Lebenssituation der Prostituierten nicht, deren elender Alltag zwischen Machtspielen und Intrigen vom permanentem Zwang, Geld einzunehmen, bestimmt ist. Ständiger Mangel an fast allem und fehlende Selbstbestimmung prägen den Alltag der Wölfinnen Pompejis. Eindrucksvoll schildert die Autorin das Zusammenleben der Zwangsprostituierten. Amaras beständige Angst um ihre Gefährtinnen und sich selbst trägt ebenso wie die überwiegend gelungene Darstellung ihres Wunsches nach Freiheit zu der authentischen Atmosphäre des Romans bei. Obwohl sie der Besitz ihres Zuhälters ist, versucht sie geschickt, ihre Lebensumstände zu verbessern. Die Sprache ist von derben und ordinären Ausdrücke geprägt, die Handlung des Romans wird im Präsens erzählt, wodurch das Geschehen besonders unmittelbar wirkt. Gewöhnungsbedürftig ist neben der schwankenden Tiefe verschiedener Figuren allerdings in der deutschen Fassung in sprachlicher Hinsicht die wiederholte Verwendung von Anglizismen, etwa „Bar“, „Dinnerparty“, „sexy“, und weiterem anachronistischem Vokabular.
In ihrem Werk beleuchtet die Autorin die Antike aus einer selten gewählten Perspektive: der einer Prostituierten, die sich gegen die übermächtige Männerwelt zur Wehr setzt, für die sie kaum mehr als eine Sache ist. Dadurch ist der Roman insbesondere für Fans von feministischen Antikenromanen lesenswert, die sich nicht nur für Mythen („Ich bin Circe“, „Ich, Ariadne“, „Stone Blind – Der Blick der Medusa“), sondern auch für Alltagsschilderungen interessieren. „Die Wölfe von Pompeji“ ist der erste Band einer mehrteiligen Reihe – der zweite Teil „Das Haus mit der goldenen Tür“ erscheint im November 2023 ebenfalls im Piper-Verlag.
Philipp Buckl, Bergische Universität Wuppertal

September 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Kai Brodersen (2023), Luthers Aufruf zur Gründung von Schulen, an denen Alte Sprachen gelehrt werden (1524), Kopie der in Erfurt 1524 gedruckten Ausgabe, Transkription und Übertragung, Speyer (Kartoffeldruck-Verlag), 123 S., ISBN 978-3-939526-59-9, 7 EUR.
In ipsa tamen pueritia […] non amabam litteras et me in eas urgeri oderam; et urgebar tamen […]: non enim discerem, nisi cogerer, lautete Augustins Rückblick auf seine Schulzeit als Kind (conf. I 12). Luther hingegen kann gut 1120 Jahre später feststellen: „Ist doch jetzt alles durch Gottes Gnade so eingerichtet, dass die Kinder mit Lust und Spiel lernen können, gleich, ob es sich um Sprachen oder andere Wissenschaften oder Historien handelt. Es gibt jetzt nicht mehr die Hölle und das Fegefeuer unserer Schulen, in denen wir gemartert worden sind […]“ (S.64f.). Unter dieser Prämisse empfiehlt der Reformator den Bürgermeistern und Ratsmitgliedern der deutschen Städte mit Nachdruck die Gründung neuer Schulen nicht nur als eine naturgegebene Notwendigkeit, sondern vor allem als ein göttliches Gebot, abgeleitet aus Ps. 78,5f., Stellen des Pentateuch und Matthäus 19,14; ja, er sehe sogar eine Sünde darin, Kinder nicht zu unterweisen. Wie schon ein Holzschnitt auf der Titelseite seiner Denkschrift erkennen lässt, schließt er Mädchen ausdrücklich in sein Schulkonzept ein (vgl. dazu auch S.62f.). Den hauptsächlichen Lehrgegenstand des Unterrichts sollten unter Bezugnahme auf Augustin (S.50f.) alle „Sprachen des biblischen Originaltextes“ (S.13) darstellen, da sich Klosterschulen und Hochschulen in einem Niedergang befänden und nicht einmal mehr zur Beherrschung des Lateinischen und Deutschen befähigten (S.26f., 46f.). Dabei seien „die Sprachen die Scheiden, worin das Messer des Geistes steckt“ (S.46f.). Insofern diene ihre Kenntnis nicht nur christlicher Charakterbildung, Theologie und Kirche, sondern eben auch allen weltlichen Belangen (S.40-63), indem „das ganze Volk – also Männer und Frauen – geistig gehoben“ werde (S.13). Mit dieser Intention fordert Luther von den Städten, die Träger neuer Bildungseinrichtungen, also neben Schulen auch von Bibliotheken, zu werden. Ihm folgten, wie der Herausgeber mitteilt, noch im gleichen Jahr 1524 die Städte Gotha, Halberstadt, Magdeburg und Nordhausen, in den folgenden Jahren Eisleben, Nürnberg und 1540 Speyer (S.13). Zu den sogenannten evangelischen Ratsschulen, auf die sich „die meisten der heute noch bestehenden humanistischen Gymnasien“ zurückführen, gehört auch das Speyrer Gymnasium am Kaiserdom. Seinem Schulleiter, OStD Hartmut Loos, ist die neue Edition von Luthers Aufruf als Festschrift zum 65. Geburtstag und zum Eintritt in den Ruhestand gewidmet. Sie stellt aber ebenso eine anerkennende Würdigung für ihn als langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden des Deutschen Altphilologenverbandes dar, der in beiden Funktionen sein Leben und Wirken der Bewahrung der antiken Kultur und der Förderung der Alten Sprachen ganz im Geiste des Reformators, aber in zeitgenössischem Gewand gewidmet hat. Trotz seines Alters hat das dargebrachte Dokument nichts an aktueller Strahlkraft verloren, sondern stellt in unserer Gegenwart eine durch die Autorität seines Verfassers zeitlos eindringliche, leidenschaftliche Mahnung dar, die geistigen Errungenschaften der Antike durch die Kenntnis ihrer Sprachen als Kultur- und Bildungsgüter immer wieder auf’s Neue zu erschließen und dadurch den menschlichen Charakter zu formen.
Das Buch mit dem Faksimile einer Kopie von Luthers Aufruf aus dem Jahr 1524 (S.85-116), seiner Transkription, seiner Übertragung (S.16-83), einer Einführung des Herausgebers (S.9-14), Erläuterungen (S.117-121) und einem Register (S.122f.) ist deshalb jedem Altphilologen als Lektüre wärmstens zu empfehlen.
Michael Wissemann
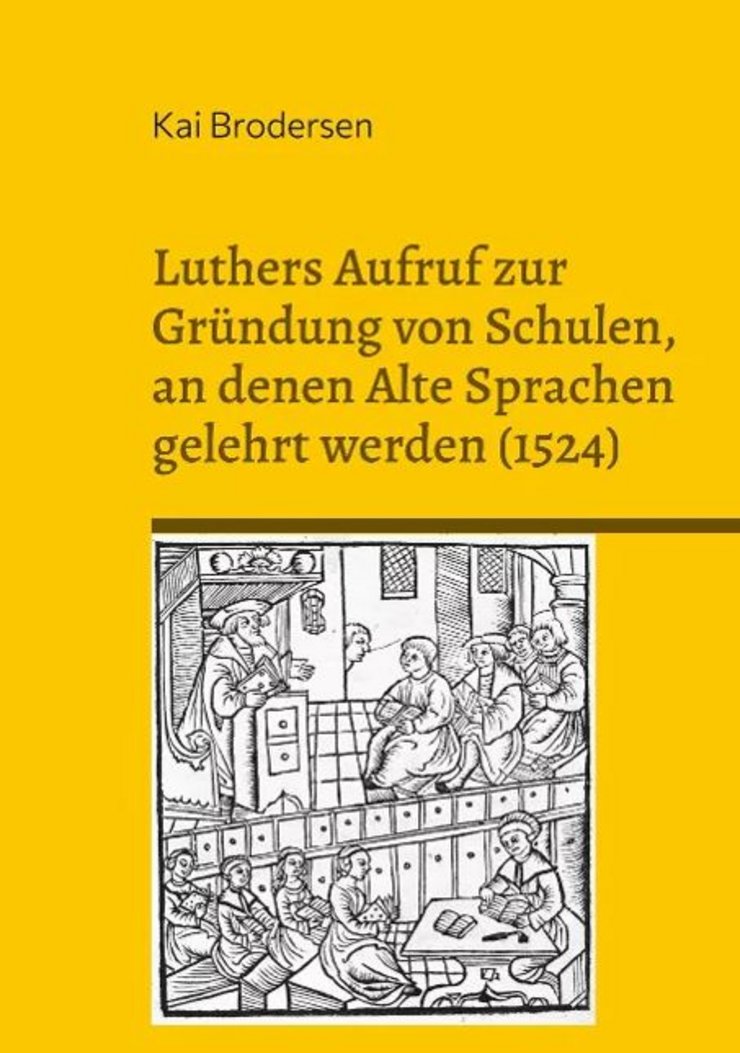
August 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Der Deutsche Altphilologenverband und seine Gründungsväter – einige Bemerkungen anhand eines neuen Buches über den Latein- und Griechischlehrer Otto Morgenstern.
Gerd Kley / Detlef Peitz: Otto Morgenstern. Gymnasiallehrer, Altphilologe, Kommunalpolitiker, Stenograf. Berlin / Leipzig: Hentrich & Hentrich 2023 (Jüdische Miniaturen 314). 104 S. 9,80 €.
Beinahe ein Saeculum ist der Deutsche Altphilologenverband nun alt, bald jährt sich zum hundertsten Mal seine Gründung, die am 6. April 1925 „abends 7 Uhr“ am Rande der von Werner Jaeger initiierten Tagung „Das Gymnasium“ in Berlin stattfand.[1] Die frühen Jahre sind vor allem im Sonderheft 1987 des „Mitteilungsblatts des Deutschen Altphilologenverbands“ von Erich Burck beschrieben (die weitere Geschichte des DAV behandeln im selben Heft Adolf Clasen und Andreas Fritsch), der sich wiederum auf Otto Leggewie, MDAV 1974/3, 14-15 stützt. Weder Burck noch Leggewie haben aber echte Quellenarbeit betrieben (oder dokumentiert)[2], so dass die mündliche, immer wieder repetierte Erzähltradition eine wesentliche Rolle zu spielen scheint.[3]
Über die bei Leggewie und Burck aufgeführten professoralen Gründungsmitglieder gibt es genügend Angaben zu Biographie und wissenschaftlichem Œuvre, allen voran über Werner Jaeger (daneben sind bei Burck genannt: Eduard Fraenkel, Otto Regenbogen, Walther Rehm [recte: Albert Rehm?], Otto Immisch und Richard Meister [ein Österreicher, denn es gab auch einen österreichischen Landesverband, ebenso wie einen für Danzig][4]). Anders sieht es für die schulischen Vertreter der Altphilologie aus („W“: Wikipedia-Eintrag): Emil Kroymann (W), Hans Lamer (W), Otto (recte: Oskar) Viedebantt (W)[5], Bernhard (recte: Paul) Gohlke[6], A. [scil. Arthur] Krause, Bernhard Kock (W). Längere Würdigungen erhielten Kroymann[7] und Kock[8]. Akten aus dieser Zeit scheinen nicht zu existieren, man kann einen Eindruck von der Verbandsarbeit aus den Berichten im mittlerweile digitalisierten „Humanistischen Gymnasium“ und auch den zunächst als Beilage zu dieser Zeitschrift seit 1927 erschienenen „Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbandes“ gewinnen, vieles bleibt aber im status coniecturalis.[9] Das fundamentale Defizit bei der Aufarbeitung der Verbands- und Fachgeschichte gerade auch der Zeit vor 1945, das Andreas Fritsch (Anm. 2) 2010 konstatiert, besteht im Grunde genommen bis heute so gut wie unverändert fort – und das ist schon deshalb misslich, weil der DAV zwar als Motto „Zukunft braucht Herkunft“ gewählt hat, aber über die eigene Herkunft nur wenig weiß.
*
Einer der in der Fachgeschichte weitgehend vergessenen Lehrer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die aber für die Geschichte des altsprachlichen Unterrichts und seiner Institutionen höchst bedeutsam waren, ist Otto Morgenstern: Geboren 1860 in Magdeburg, aufgewachsen in Berlin, nach dem Studium in Tübingen und an der Berliner Universität seit 1885 Lehrer für die Alten Sprachen (auch Hebräisch und Stenographie) an Gymnasien im Raum Berlin, von 1888 bis 1925 am Schiller-Gymnasium in (Groß-)Lichterfelde (ab 1920: Groß-Berlin).
In der NS-Zeit wurde der protestantisch Getaufte aufgrund seiner jüdischen Wurzeln für ihn völlig unerwartet Opfer der Rassengesetze und schließlich 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er noch im gleichen Jahr starb. Auch wenn ein Stolperstein, eine Gedenktafel und ein Straßenname an Otto Morgenstern erinnern, gibt es wohl nur wenige oder niemand aus den Reihen der Vertreter der Alten Sprachen, die mit seinem Namen etwas anfangen könnten. Deshalb ist man (zumindest: bin ich) sehr dankbar, dass Otto Morgenstern in der Reihe „Jüdische Miniaturen“ nun eine kleine Biographie erhalten hat. Verfasser sind Gerhard Kley – nach eigenem Bekunden als früherer Physiker nun als Historiker mit einem besonderen Interesse am Berlin-Brandenburgischen Raum tätig (dem Nachwort nach zu schließen der Initiator) – und Detlef Peitz – promoviert mit einer Arbeit über Thomas von Aquin, seit mehr als einem Vierteljahrhundert führender Stenograph im Deutschen Bundestag und deshalb an der Geschichte der Stenographie besonders interessiert sowie durch einschlägige Publikationen ausgewiesen (vgl. das wissenschaftliche Profil unter https://independent.academia.edu/DetlefPeitz).
Die Interessenschwerpunkte der beiden Autoren sind auch in der Anlage des Buchs deutlich spürbar: Otto Morgenstern war nämlich nicht nur Altphilologe, sondern auch leidenschaftlicher Anhänger der im 19. Jahrhundert entstandenen Stenographenbewegung, finanzierte sein Studium mit Stenographiestunden und war auch selbst als Vortragender und Prüfender noch bis ins fortgeschrittene Alter engagiert. Als einer der führenden Kommunalpolitiker in Lichterfelde und nach Gründung von Groß-Berlin 1920 als Bezirksverordneter im Bezirk Steglitz (als Mitglied der rechtsliberalen, aber dank Stresemann republikanischen DVP) engagierte er sich für das Gemeinwohl, für Büchereien, für die Linderung des Elends in den Weltkriegsjahren und auch für die Gründung des (bis heute bestehenden) Steglitzer Schloßparktheaters. Das alles (und noch viel mehr: z.B. über die ziemlich bizarre Brocken-Silvester-Gemeinde) erfährt man aus dem schmalen Büchlein, wobei die Auswertung der Steglitzer Archiv- und Museumsbestände ebenso wie die Quellen zur Stenographiegeschichte eine wichtige Rolle spielt. Es entsteht ein facettenreiches und im gegebenen Rahmen durchaus fundiertes Bild eines für seine kommunale Gemeinschaft engagierten und deswegen angesehenen Bürgers.
Über Morgenstern als Lehrer und in der philologischen Öffentlichkeit in Berlin, was bei Kley/Peitz eher knapp behandelt wird, folgen gleich noch eine Reihe von Anmerkungen. Zunächst aber sei kurz auf die letzten Jahre Morgensterns geblickt, auf die Zeit zunehmender Entrechtung, enttäuschter Hoffnungen und schließlich seiner Tötung. In den Kontext dieser letzten Lebensjahre gehören auch die beiden Texte, die aus heutiger Sicht besonders verstörend wirken, die Broschüre über Horaz als protonationalsozialistischen Dichter und das lateinische Lobgedicht auf den Friedenswillen Adolf Hitlers (auch dazu gleich mehr). Am Ende des biographisch-darstellenden Teils ihres Buches schildern die Autoren das selbst in sachlichem Bericht erschütternde Schicksal von Otto Morgenstern in der letzten Zeit vor der Deportation sowie das seiner beiden Schwestern, die bald nach ihm nach Theresienstadt deportiert wurden und ebenso dort umkamen. Die Überlieferung über diese letzten Phase verdankt sich den Erinnerungen von Otto Morgensterns Nichte Christa-Maria, die den Zweiten Weltkrieg überlebte, sowie weiteren v.a. im Steglitzer Heimatarchiv aufbewahrten Materialien, die sorgfältig und pietätvoll zusammengetragen sind.
*
So verdienstvoll das Buch in der bisher dargestellten Hinsicht ist, bei der Würdigung des Schulmannes Morgenstern muss man leider deutliche Abstriche machen, denn so manches Fachgeschichtliche und Bildungspolitische ist den Autoren doch spürbar fremd geblieben, so dass der ihm so wichtige Beruf beinahe marginalisiert wird.[10] Da Morgenstern mit Leib und Seele Lehrer der Alten Sprachen war, ist damit ein wesentliche Aspekt seiner Biographie betroffen, zugleich bietet gerade seine Person die exemplarische Möglichkeit, auf die Zeit zu blicken, in der der DAV als Lobby des Griechischen und Lateinischen in der Schule gegründet wurde. Eine Berufsbiographie kann und will ich nicht liefern, aber doch einige Aspekte skizzieren, die zugleich protreptisch wirken sollen.
Man kann sich für die Annäherung auf drei Arten von Quellen stützen: 1. auf die üblichen schulgeschichtlichen Quellen wie Jahresberichte, die Festschrift zum 50jährigen Schuljubiläum und die im Vergleich zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg enorm umfangreichen Publikationen in schulischen Zeitschriften wie der Berliner Philologischen Wochenschrift und der Wochenschrift für Klassische Philologie, dem Sokrates, dem Humanistischen Gymnasium oder auch dem amtlichen Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen; 2. auf Morgensterns eigene Publikationen im Umkreis der Tagung „Das Gymnasium“ sowie seine späten Publikationen in den von der NS-Herrschaft geprägten letzten Jahren seines Lebens; 3. auf ein singuläres Buch, den „Roman nach Dokumenten“ von Heinz Schwitzke „Das einundzwanzigste Kapitel“ (Anm. 22), in dessen rahmenden Passagen Otto Morgenstern eine wichtige Rolle spielt.
Prinzipiell war Morgenstern keiner der deutschen Studienräte, die im Gefolge der Humboldt’schen Universitäts- und Schulreform eher Gelehrte als Pädagogen waren - pars pro toto sei im Kontrast dazu als Angehöriger seiner Generation Hugo Magnus (1851-1924) genannt, der neben seiner Tätigkeit am Berliner Sophien-Gymnasium die bis heute unersetzte editio maior von Ovids Metamorphosen (Berlin 1914) schuf. Otto Morgenstern war anders als viele Altphilologen nicht promoviert, er war vielmehr dezidiert Praktiker und Organisator[11], der zahlreiche verantwortliche Positionen (vom Kassenwart der Witwen- und Waisenkasse des Schiller-Gymnasiums[12] bis zum Bezirksverordneten) übernahm und in seiner Gemeinde Groß-Lichterfelde (bzw. dann im entsprechenden Groß-Berliner Bezirk) hohes Ansehen genoss. Auch an der Ausbildung von Lehrkräften war er beteiligt, da er im dem Schiller-Gymnasium angeschlossenen Seminar „Übungen“ leitete.[13]
Seine umfangreichste Abhandlung zu fachwissenschaftlichen Themen stammt schon aus dem Jahr 1894, die Curae Catullianae[14], textkritische Untersuchungen im Geiste des 19. Jahrhunderts, die auf einen im gleichen Jahr gehaltenen Vortrag im Berliner Philologischen Verein zurückgehen[15] und die selbst von Vereinsmitgliedern keineswegs enthusiastisch aufgenommen wurden.[16] Die späteren Publikationen Morgensterns zu fachwissenschaftlichen Themen kommen nicht über den Charakter von Miszellen hinaus.[17]
Morgensterns umfangreichste eigenständige Publikation gilt demgemäß nicht einem wissenschaftlichen, sondern einem didaktisch-methodischen Thema. Es handelt sich um die Schrift „Vom Lateinlernen“ aus dem Jahr 1922, die auf zwei Vorträgen beim Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht im Rahmen von „Osterferienkursen“ (also einer Fortbildungsveranstaltung) basiert.[18] Hier findet der Leser (und die primäre Zielgruppe waren natürlich männliche Lehrkräfte) weder eine emphatische Rechtfertigung des Latein noch eine neue didaktische Theorie, vielmehr eine ganze Reihe von alltagstauglichen Hinweise, beginnend mit der richtigen Fragetechnik über die Einbeziehung von Fremdwörtern und Hinweisen für die Wahl der Schulgrammatik sowie des Übungsbuches bis zu Hinweisen zum Übersetzen vom Deutschen ins Lateinische sowie der Aufbereitung des Wortschatzes. Wenn man ein wenig zwischen den Zeilen liest und versucht, der im Text präsenten Stimme des Autors nachzuspüren, erfährt man auch manches über den Lehrer Otto Morgenstern, auch wenn der Anfangsunterricht damals schon lange nicht mehr seine Hauptbeschäftigung war[19], sondern die Krönung des Lateinunterrichts in der Prima.[20]
Das Bild Morgensterns[21] wird von unerwarteter Seite wesentlich bereichert, nämlich durch das Nachwort in Heinz Schwitzkes Roman „Das einundzwanzigste Kapitel“.[22] Der Romanplot einer fiktiven Dokumentation kann beiseite bleiben, wichtig ist hier die Erinnerung Schwitzkes[23] im Anhang (S. 253-310) an seinen Lehrer Morgenstern, den er erzählerisch mit der Geschichte des Frühchristentums verflicht. Schwitzke erzählt von der Musik- und besonders Opernleidenschaft Schwitzkes, seiner Tätigkeit im Stenographenverein der Schule, wo er die Schüler auch in die römische Geschichte der Kurzschrift einführte, und dann von der szenischen Realisierung des Chors aus Sophokles‘ Antigone[24] auf dem Schulhof, womit er den Schülern auch die enge Verbindung von Inhalt und Metrik demonstrierte. Immer wieder taucht in der Schilderung von Morgensterns Wirken als Lehrer die Bedeutung auf, die Horaz für ihn hatte – und als Lateinlehrer der Prima hatte er noch immer das Privileg, die Oden des Horaz als einen der Höhepunkte antiker Dichterlektüre zu unterrichten. Es wird deutlich, was den Lehrer Morgenstern eindrucksvoll machte: die Vermittlung von antiken Texten höchster Qualität mit aller fachlichen Kompetenz, die zugleich die Wirklichkeit der Schüler nicht aus dem Blick verlor und von ihr ausging. Morgenstern war so sehr mit Leib und Seele Lehrer, dass er als eine Art von persönlicher Kränkung empfand, im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand treten zu müssen und allenfalls noch sporadisch als Aushilfe geholt zu werden.[25]
Das neben dem Unterricht zweite wichtige Standbein von Otto Morgensterns Lehrerberuf war seine organisatorische Tätigkeit.[26] Schon 1894 war er dem Philologischen Verein zu Berlin beigetreten, einer Gemeinschaft schulischer und universitärer Altphilologen, die das συμφιλολογεῖν pflegten. Dort hielt auch Morgenstern gelegentlich Vorträge zu philologischen Spezialthemen, vor allem aber war er als Schriftführer in einer Art von Notarfunktion.[27] Diese Einbindung in die Berliner philologische Landschaft und das damit verbundene Organisationsgeschick dürfte dazu geführt haben, dass Morgenstern zu den Organisatoren der von Werner Jaeger initiierten Tagung „Das Gymnasium“[28] im April 1925 zählte. Der Stellenwert dieser Tagung und der daraus entstandenen Publikation wird sowohl von Schwitzke[29] als auch von Kley/Peitz (S. 33-34) viel zu wenig gewürdigt. Diese Tagung war eine zwar von Berlin ausgehende, aber beileibe nicht auf Berlin beschränkte Verteidigung des von vielen Seiten bedrängten Humanistischen Gymnasiums durch die sie tragenden wissenschaftlichen Disziplinen, die vor allem durch die Publikation[30] – und für sie war Otto Morgenstern zuständig – lang andauernde Wirkung (nach der Unterbrechung durch die NS-Schulpolitik auch noch in der Nachkriegszeit) erzielte.
Im Vorwort legt Morgenstern dar, dass ihm die organisatorische Vorbereitung übertragen wurde, nachdem der ursprünglich vorgesehene Ernst Goldbeck, der Gründer des Reichsausschusses zum Schutz des humanistischen Gymnasiums“[31], aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe abgeben musste. Inhaltlich verantwortlich waren neben Morgenstern im Tagungsvorstand Werner Jaeger sowie Emil Kroymann (Direktor des Gymnasiums Steglitz, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Humanistischen Gymnasiums und erster Vorsitzender des DAV) sowie Walter Kranz, der damals schon für höhere Weihen prädestiniert schien. Dass Morgenstern eher für den äußeren Ablauf als für die Inhalte zuständig war, zeigt sein eigener Beitrag „Lehrervorbildung und Lehrerauslese“ (ibd. 261-269): Das ist keine fachwissenschaftliche oder fachdidaktische Abhandlung, sondern ein nachdrückliches Plädoyer für die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit, die sich mit ihrer Aufgabe, dem Blick auf das gymnasiale Ganze und nicht nur auf das Einzelfach, voll und ganz identifizieren muss, um Erfolg zu haben. Im Kontext der grundsätzlichen Erörterungen der Tagung war dieser aus der Praxis gearbeitete Beitrag aber eher randständig.[32]
Stärker Morgensterns eigene Handschrift zeigen die sowohl bei Schwitzke als auch Kley/Peitz genannten, aber nicht ausgewerteten Flores Gymnasiales, das „Festbüchlein für den geselligen Abend“ der Gymnasium-Tagung (Berlin 1925).[33] Dieses Büchlein ist nicht nur von Otto Morgenstern zusammengestellt, es enthält auch eigene Texte und Übersetzungen.[34] Das beginnt mit den vier Auftaktgedichten (eine Einladung in griechischen, lateinischen und deutschen Versen sowie ein weiteres griechisches Gedicht), es folgen etwa die Übersetzung von Wandinschriften aus Pompei sowie griechischen und lateinischen Sentenzen als möglicher Schmuck für die „Klassenzimmer deutscher Gymnasien“, darunter das berühmt-berüchtigte Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται, übersetzt: „Wer erzogen werden will, muß Haare lassen.“ Aufschlussreich ist der selbst in diesem Kontext eingefügte Seitenhieb auf „die Franzosen“ unter dem Titel „Goethe als Plagiator“ (die Einleitung zu einer lateinischen Übersetzung in elegischen Distichen von „Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n?“)[35] sowie im von ihm gedichteten Lied „Stoßt an, das Gymnasium lebe, hurra hoch!“ mit Blick auf die Abschaffung des obligatorischen Französisch-Unterrichts. Hier wird deutlich, dass damit verbunden der Hass auf die „Novemberverbrecher“, die Quasi-Verteidigung des Kapp-Putsches (von Kley/Peitz S. 48-50 ausführlich anhand der Erinnerungen von Robert Kempner dargestellt) und die späteren Äußerungen in der NS-Zeit so etwas wie eine kontinuierliche Linie bilden.[36]
Der Deutsche Altphilologenverband wurde am Rande dieser Tagung gegründet, die Gründung war von vornherein vorgesehen, so dass im Programm dafür entsprechend Zeit eingeplant war.[37] Es ist undenkbar, dass Morgenstern an dieser Planung nicht beteiligt war. Dass er selbst aber im DAV keine führende Rolle spielte, dürfte daran gelegen haben, dass just zu diesem Zeitpunkt seine Pensionierung anstand (der Groß-Berliner Landesverband entstand schon am 23. März 1925, also noch vor dem Gesamtverband). Immerhin ist er aber als Vortragender im Landesverband Berlin-Brandenburg belegt, was noch mehr ein Indiz dafür ist, dass er der Sache mit Sympathie gegenüberstand. Zu nennen ist beispielsweise sein Vortrag über den „griechischen Elementarunterricht“ in der Junisitzung 1925 des DAV-Landesverbandes.[38] In der Vertreterversammlung des Gesamt-DAV am 2. und 3. Oktober 1931 in Weimar befasste sich „Herr Morgenstern (Berlin)“ in einer „ausführlichen Erörterung“ mit dem „mittelalterlichen und Renaissance-Latein“[39] (Morgenstern war also Berliner Delegierter). Eine weitere Verbindung Morgensterns zum DAV besteht in der Tatsache, dass der 1927 zum Vorsitzenden des Berlin-Brandenburger Landesverbandes gewählte Paul Babick[40] der Direktor des Schiller-Gymnasiums war.
Otto Morgenstern spielte also vor allem in den 1920er Jahren in Berlin und darüber hinaus eine wichtige Rolle, er unterstützte durch sein ganz offenbar vorhandenes Organisationstalent diejenigen, die die Sache des Humanistischen Gymnasiums stärken wollten. Das allein würde ihm schon legitimerweise einen Platz in der Ahnengalerie des DAV verschaffen. Er verkörperte sicher den Humanismus über das Griechische und Lateinische als dafür konstitutive Sprachen in einer den Menschen zugewandten Weise mehr als sein Quasi-Schulnachbar, der Direktor des Gymnasiums Steglitz und erste DAV-Vorsitzende Emil Kroymann.[41]
*
In seinem letzten Lebensjahrzehnt wurde Otto Morgensterns als national gesinnter Protestant jäh auf seine jüdische Genealogie zurückgeworfen und musste – auch wenn er sich das zunächst nicht eingestand - die zunehmende Entrechtung erfahren, bis er schließlich nach Theresienstadt deportiert wurde. Das ist sowohl von Kley/Peitz als auch von Schwitzke eindringlich geschildert (wobei ich für die bei Schwitzke dargestellte Hinwendung zur frühchristlichen antiken Literatur keinen Quellenbeleg finde, so dass eher fiktive Dokumente im Roman anzunehmen sind).
Wenn man die bisherige altphilologische Perspektive weiter beibehält, dann lassen sich aber doch Ergänzungen und Justierungen anbringen. Otto Morgenstern ist kein Einzelfall. Man muss nur auf Eduard Norden schauen, von 1906 bis 1935 als Professor für Klassische Philologie an der Berliner Universität tätig und danach unter Zwang emeritiert. Ihm gelang immerhin – anders als Morgenstern – noch im Sommer 1939 die Emigration in die Schweiz, wo er 1941 starb. Auch von Norden sind eine Reihe (allerdings nicht öffentlicher) affirmativer Äußerungen überliefert[42] - und Eduard Norden war beinahe Morgensterns Nachbar in Lichterfelde (von der Karlsstr., umbenannt in: Baseler Straße 64 zur Söhtstraße 2 waren und sind es gerade einmal 20 Minuten Fußweg), beide waren im Philologischen Verein[43] aktiv, beide waren Mitglied im fünfköpfigen Ausschuss für Alte Sprachen der „Preußischen Prüfstelle für Lehrbücher“[44] und beide waren Angehörige der protestantischen Paulusgemeinde in Lichterfelde. Morgenstern war einer der Spender für die 1928 gegründete Eduard-Norden-Stiftung und zudem Lehrer von Nordens Sohn Erwin.[45] Sie teilten die nationalkonservative Perspektive auf die Politik, die sie blind machte für die Realität des Nationalsozialismus, was bei Norden eher im Verstummen, bei Morgenstern auch im Versuch, aktiv zu werden, resultierte.
Die Illusion, auch unter den Bedingungen des Nationalsozialismus nicht ganz aus den früheren Leben ausgeschlossen zu sein, nährte wohl auch die Festschrift „50 Jahre Schillergymnasium“[46], in der er mehrfach gepriesen wurde und an der er auch selbst mitwirken konnte, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der Direktor Paul Babick schon 1933[47] und auch in der Festschrift 1935 als nachdrücklicher Vertreter des Nationalsozialismus hervortrat.[48] Morgenstern konnte sich vielmehr gerade im Umfeld der Kollegen des Schillergymnasiums wie ein Pensionist wie jeder andere auch fühlen, wenn er denn das ausblendete, was um ihn herum geschah.
In der Zeit der Feier des Schuljubiläums lud Otto Morgenstern ehemalige Schüler zu einer speziellen Unterrichtsstunde ein. Heinz Schwitzke berichtet von „mehr als achtzig“, die „andächtig zu seinen Füßen saßen“.[49] Das Thema der Stunde war „Horaz und der Nationalsozialismus“, unmittelbar aus dem Manuskript ließ Morgenstern den Text auch drucken.[50]. Hier versucht Morgenstern, in dem römischen Dichter (ob man ihn beim heutigen Stand der Horaz-Forschung noch als „glühenden Anhänger des Augustus“ [Kley/Peitz, S. 51] bezeichnen sollte, darüber lässt sich trefflich streiten) eine Art von Propheten der nunmehrigen Gegenwart zu sehen.
In seinem Vortrag nimmt Morgenstern ausdrücklich auf Direktor Paul Babicks Rede „Der Humanismus und die nationale Erhebung“ von 1933[51] Bezug (S. 6) und unternimmt es, die dort aufgestellten fünf Prinzipien nationalsozialistischer Bildung anhand von Horaz auszuformulieren (Nationalgefühl; vaterländischer Opfersinn; Rassenstolz; Erziehung zu Staatsgesinnung und Volksgemeinschaft; Führergedanke; Sozialismus [S. 6]). Das tut er in einer die Zitate unterschiedlicher Provenienz aneinanderreihenden Blütenlese, in dieser Hinsicht tatsächlich ein wenig Georg Büchmanns „Geflügelten Worten“ vergleichbar, ein im Bildungsbürgertum weit verbreitetes Buch, das Morgenstern als Beweis für die Bedeutung des Horaz auch in der eigenen Gegenwart anführt (S. 4).[52] Morgenstern nennt aktualisierend die Herrschaft des Augustus ein „drittes Reich“ (S. 6, nach Königtum und Republik)[53], Horaz wird „Verbundenheit mit dem Boden der Heimat“ (S. 7) zugeschrieben. Soweit eigene Übersetzungen beigegeben sind (S. 8), akzentuieren sie das Lateinische in Richtung auf den von Morgenstern angestrebten Effekt, etwa wenn er von carm. 4,4,29-32 nur die rahmenden beiden Verse übersetzt und damit die heldenzeugenden Helden (bei Horaz ist lediglich von „Tapferen und Guten“ die Rede) mit den Adlern zusammenbringt, die zwischen diesen stehenden Aussagen über die Vererbung bei Rindern und Pferden aber auslässt – das passte wohl nicht in den angenommenen Zeitgeist.[54]
Für diese singuläre und auch gespenstische Veranstaltung gab es wohl ein ganzes Bündel von bewirkenden Faktoren. Die „Unterrichtsstunde“ ist (so wird am Ende [S. 11] deutlich) zunächst im größeren Zusammenhang des 50jährigen Schuljubiläums[55] zu sehen: Wenn es offenbar schon keinen Festvortrag gab, so wurden auf diese Weise ehemalige Schüler wieder in ihre Schule geholt. Das wäre in anderen Zeiten harmlos gewesen, ebenso harmlos, das als Auftakt zu einer innerschulischen Feier zum 2000. Geburtstag des Horaz (geb. 8. Dezember 65 v.Chr.) werden zu lassen. Morgenstern konnte auf diese Weise seine persönliche Liebe zu Horaz[56] in einen passenden Rahmen stellen. Allerdings ist es undenkbar, dass der Direktor einen solchen Vortrag des rassisch Verfemten in den Räumen der Schule nicht ausdrücklich erlaubt hätte, und das trotz seiner auch öffentlich geäußerten nationalsozialistischen Überzeugung.
Morgenstern steht aber mit seiner Vereinnahmung des Horaz beileibe nicht alleine da[57], denn fast parallel dazu unternimmt der Ulmer Gymnasiallehrer Alfred Hauser ebenfalls von Babick ausgehend einen Versuch, die Oden des Horaz für den Unterricht zu erhalten, wobei er aber Babicks Skepsis über die Eignung des Dichters deutlicher benennt als Morgenstern und dieser Skepsis entgegenzuwirken versucht.[58] Das gleiche Streben nach einer Rettung des Horaz aus dem Geist des Nationalsozialismus spricht aus dem Beitrag des damals in Steglitz wirkenden Hugo Schaefer[59] (also in Morgensterns unmittelbarer Nachbarschaft), der – dieses Mal ohne Bezug auf Babick, aber auch nich mit Bezug auf Morgenstern – die Eignung von Vergil und Horaz für den Lateinunterricht im Nationalsozialismus herauszuarbeiten versucht.[60] Obwohl Horaz in den Lehrplänen des 20. Jahrhunderts immer weiter in den Hintergrund getreten war, schien er also für die Zwecke von pathetischen Bekenntnissen noch geeignet.
Diese Kontextualisierung macht Morgensterns 25 Minuten langen (S. 6) Vortrag nicht weniger erschreckend und bizarr, im Gegenteil: Denn anders als seine unrühmlichen Mitstreiter gehörte er zu den als Juden Verfemten und letztlich Getöteten, auch wenn er über römischen und deutschen „Rassenstolz“ sprach. Im Frühjahr 1935 konnte man sich bei entsprechender Disposition vielleicht Illusionen machen, es werde schon nicht ganz so schlimm kommen, denn immerhin waren die Nürnberger Gesetze noch nicht erlassen und auch Eduard Norden hatte noch kurz zuvor als Professor wirken können, bis er mit dem Ablauf des Wintersemesters nach außen hin regulär, in Wahrheit natürlich unter Zwang emeritiert wurde. Die Hoffnung, die Morgenstern auf seine Loyalitätsbekundung setzte, zeigt sich an der Eiligkeit der Publikation („als Manuskript gedruckt“, also unredigiert und ohne die Einbeziehung eines Verlags) und auch an der weit gestreuten Verbreitung auf privatem Weg.[61]
Inhaltlich musste sich Morgenstern nicht sehr verbiegen, denn es handelt sich um eine konsequente, wenn auch tragische Fortsetzung seines politischen Denkens seit dem Ersten Weltkrieg.[62] Das führt zum zweiten Text Otto Morgensterns, der ausdrücklich die Politik Adolf Hitlers begrüßt, zum Gedicht „Pax et Bellum“, das den „Anschluss“ des Sudeten- und Memellandes sowie Österreichs als friedensstiftende Tat Hitlers preist: bella gerant alii. Die Inspiration für diese einleitenden Worte, die das bekannte Lob der habsburgischen Politik zur Mehrung Österreichs (… tu felix Austria nube!) auf Deutschland überträgt, dürfte eben im Bezug auf Österreich liegen (der „Anschluss“ Österreichs fand im März 1938 statt). Die drei elegischen Distichen sind metrisch korrekt gebaut, auch die modernen Toponyme Sudeti (die Prosodie ergibt sich aus Σούδητα bei Claudius Ptolemaeus) und Memelae sind richtig eingepasst, Morgenstern hat sein Handwerkszeug also nicht verlernt, insofern reiht sich das epigrammatische Gedicht in die lange Reihe seiner Gelegenheitsgedichte ein,[63] wie etwa das Genethliakon auf das Schiller-Gymnasium in der Festschrift. Der Inhalt jedoch ist ganz und gar nicht harmlos und je nach Perspektive und Grad des Wohlwollens gegenüber dem Verfasser geprägt von Naivität, Blindheit, Selbstverleugnung oder völligem Opportunismus. Denn die letzten beiden Verse stellen in Übereinstimmung mit der NS-Propaganda den angeblichen deutschen Friedenswillen dem invidiae furor ater der namentlich nicht genannten Feinde gegenüber, die Deutschland den Krieg aufgezwungen hätten (ad arma coëgit). Das lässt das Gedicht auf die Zeit nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 datieren, der propagandistisch als unmittelbare Antwort auf polnische Angriffe (der sog. Überfall auf den Reichssender Gleiwitz) dargestellt wurde.
Das Gedicht wurde auf Latein und Deutsch in der Brocken-Silvester-Post zum Jahreswechsel 1939/1940 publiziert, also in eher privatem Rahmen der Freunde in der Brocken-Silvester-Gemeinde.[64] Der Tenor passt zum Jahresmotto „Was wir 1939 erlebten, ist Weltgericht um Rasse und Blut“ – und Morgenstern hat wieder ignoriert, dass Rasse ein auch gegen ihn gerichteter Kampfbegriff war und es ihm verwehrt war, sich die Seite seiner Verfolger zu schlagen. In einem einer breiteren Öffentlichkeit zugänglichen Medium hätte er als Jude weder einen solchen noch einen anderen Text drucken lassen können.
Umso erstaunlicher ist es, dass dieses Gedicht noch einmal gedruckt wurde, nämlich im August 1941 in der in München publizierten Zeitschrift „Societas Latina“, die sich der Pflege der Latinitas Viva verschrieben hatte.[65] Die „Societas Latina“ hatte bereits im Februar 1940 (De institutione aetatis puerilis) einen Text Morgensterns gedruckt und wiederholte das im September 1942 (das Gedicht quo loco lepidus). Wie diese Texte dorthin gelangten, ist (mir noch) nicht klar, zumal eine frühere Verbindung Morgensterns zu dieser Zeitschrift nicht feststellbar ist. Eventuell handelt es sich seitens der Societas Latina um einen Akt stillen Widerstands gegen das Hitlerregime, dem der Herausgeber Georg Lurz[66] so kritisch gegenüberstand, dass er als Schulleiter des Münchner Wilhelmsgymnasiums wegen seiner kompromisslos katholischen Haltung schon 1934 in den Ruhestand versetzt wurde.[67] Zwischen der Erstpublikation und dem Abdruck in der „Societas Latina“ hatte Hitler nach dem Sieg über Frankreich und der Expansion auf dem Balkan nunmehr im Sommer 1941 die Sowjetunion überfallen lassen. Mochte auch das als Präventivkrieg propagandistisch gerechtfertigt werden, vom glücklichen Deutschland, das seine verlorenen Gebiete friedlich wiedergewinne, konnte sicher nur noch schwer die Rede sein. Ob die Societas Latina einen solchen Unterton mit der unveränderten Publikation verband, darüber lässt sich aber nur spekulieren.
*
Otto Morgenstern war eine tragische Figur, „tragisch“ über den unscharfen Alltagsgebrauch hinaus im aristotelischen Sinne. Denn nach Aristoteles hat ein tragischer Held einen „mittleren“ Charakter zu besitzen (Poetik 1453a, Übersetzung Arbogast Schmitt): „Von dieser Art ist derjenige, der weder durch charakterliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit herausragt, noch durch Schlechtigkeit und Bösartigkeit ins Unglück gerät, sondern wegen eines bestimmten Fehlers zu Fall kommt und außerdem zu denen gehört, die in hohem Ansehen stehen und im Glück leben …“ Morgensterns Leben ist das ins bürgerliche Milieu des 19. und 20. Jahrhunderts transponierte Material, aus dem Tragödien entstehen werden.
*
Am Ende steht die Frage: Soll man, soll jemand, die/der sich mit Latein und Griechisch befasst, das Buch von Kley/Peitz kaufen? Ja, auf jeden Fall (und vielleicht auch noch ein weiteres Exemplar für Kollegen). Es ist eine Basis für die weitere Suche nach der Geschichte der eigenen Disziplin, und die Kritik daran ist auch eine Herausforderung an die Vertreter:innen der Alten Sprachen, in den Dialog einzutreten und für ein Resultat zu sorgen, das die jüngere Geschichte des Altsprachlichen Unterrichts (also die Post-Paulsen-Ära) zu einem Teil der allgemeinen Bildungsgeschichte und Geschichte werden lässt. Das anstehende Jubiläum wäre dafür ein guter Anlass, das eigene kollektive Wissen zu erweitern und noch mehr Menschen wie Otto Morgenstern mit ihren guten und schlechten Seiten wiederzuentdecken: Es gibt auch jenseits von Professor Unrat und Alfred Anderschs „Vater eines Mörders“ Gebhard Himmler eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern, die die Fächer Griechisch und Latein geprägt haben.[68]
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
[1] Bericht von Grünwald, Eugen, in: Das Humanistische Gymnasium 36, 1925, S. 136-137; vgl. Mensching, Eckard: Das Festbüchlein ‚Flores Gymnasiales‘. Vor 75 Jahren wurde der DAV gegründet, in: ders.: Nugae zur Philologiegeschichte XI, Berlin 2001, S. 9-27, hier: 16 (Die überaus verdienstvollen Dokumentationen Menschings zur Philologiegeschichte interessieren sich primär für die universitäre, kaum für die schulische Seite). – Die in diesem Beitrag angeführten Verweise sind zu einem Gutteil auch digitalisiert verfügbar, auf Einzelnachweise wird hier verzichtet.
[2] Burck schreibt im Grunde genommen Leggewie fort, wobei ihm einige Gedächtnisfehler unterlaufen. Zuverlässiger, was die Namen angeht, ist Andreas Fritsch im Editorial zum Forum Classicum 53, 2010, S. 3-5.
[3] Siehe Kranzdorf, Anna: Ausleseinstrument, Denkschule und Muttersprache des Abendlandes. Debatten um den Lateinunterricht in Deutschland 1920-1980, Berlin 2018, S. 98-100.
[4] Die Rolle Eduard Nordens, die noch in Grünwalds Bericht (Anm. 1) erwähnt ist, wird in den Nachkriegspublikationen nicht mehr genannt – vielleicht eine Spätfolge von Eduard Nordens rassisch bedingtem Ausschluss aus der deutschen Philologie und deren Gedächtnis nach 1935; vgl. Mensching, Eckard: Texte von und über Eduard Norden, in: Nugae XI (Anm. 1), S. 85-112, hier 112 über das offizielle Verbot durch die NS-Behörden, in der Presse an den 75. Geburtstag von Eduard Norden zu erinnern.
[5] Siehe die Darstellung von Peter Nieveler aus der Perspektive des zuletzt von Viedebantt geleiteten Gymnasiums in Jülich: https://www.gymnasium-zitadelle.de/unsere-schule/geschichtliches/schulleiter-dr-viedebantt/
[6] En passant ein Fund der besonderen Art: Der Datenbank historischer Forschungsförderung der DFG kann man entnehmen, dass Gohlke bei der Forschungsgemeinschaft 1934 (abgelehnt, da keine wissenschaftliche Bedeutung; BArch R 73/118), 1939 (bewilligt) und 1943 (abgelehnt) Anträge auf Druckkostenzuschüsse für seine Aristoteles-Studien beantragte, was seine für den deutschen Studienrat typischen wissenschaftlichen Ambitionen unterstreicht: https://gepris-historisch.dfg.de/person/5103851).
[7] Nachruf von Sommer, Fritz, in: Gymnasium 59, 1952, S. 1-3.
[8] Zum 80. Geburtstag: Gymnasium 72, 1965, III-V.
[9] Sehr hilfreich sind auch die ScriptaPaedagogica der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, auch wenn sie auf absehbare Zeit wegen der Folgen eines Cyberangriffs vollständig lediglich auf dem Umweg über das nur schwer differenziert zu durchsuchende Portal bildungsgeschichte.ch zur Verfügung stehen.
[10] Um mit (scheinbaren) Kleinigkeiten zu beginnen. Die „Wochenschrift Klassische Philologie“ (32) gibt es nicht (es gibt die Wochenschrift für Klassische Philologie bzw. die Berliner Philologische Wochenschrift), in der Societas Latina (32) wurden von Morgenstern keine Rezensionen und Aufsätze veröffentlicht, sondern lateinische Gedichte und Traktate (dazu unten mehr). Tiro war nicht „Leibeigener“ (15), sondern Sklave (und dann Freigelassener) Ciceros. Eine Ode des Horaz „Mögest du niemals etwas Größeres schauen als die Stadt Rom“ (53) gibt es nicht, es handelt sich um die Verse 12-13 des Carmen Saeculare. Morgenstern war auch niemals Mitarbeiter des Thesaurus linguae Latinae (66) (https://thesaurus.badw.de/fileadmin/user_upload/Files/TLL/Artikelverfasser.pdf). Es geht nicht um Beckmessertum, sondern um die Frage, wie mit der Berufsbiographie Otto Morgensterns umgegangen wird.
[11] Das gilt schon für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, siehe etwa seinen fünf Druckseiten langen Bericht über die Ergebnisse der (modern gesagt) „Evaluation“ der „Dienstanweisung für die Direktoren und Lehrer der männlichen Jugend in Preußen“ mit teils ins kleinste Detail bis hin zur bequemen Zitierbarkeit gehenden Vorschlägen (Deutsches Philologenblatt 21, 1913, S. 427-431.
[12] Unausgesprochen in eigener Sache tätig setzte sich Morgenstern auch für die unter Pensionskürzungen leidenden Ruhestandsbeamten (besonders die ledigen) ein: Morgenstern, Otto: Zur Ruhegehaltsfrage, in: Deutsches Philologenblatt 35, 1927, S. 810.
[13] Festschrift (Anm. 46), S. 95.
[14] Schulprogramm des Groß-Lichterfelder Gymnasiums von 1894: https://archive.org/details/curaecatullianae00morg/
[15] Morgenstern, Otto: Der Philologische Verein in den ersten 50 Jahren seines Bestehens, in: Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Philologischen Vereins zu Berlin, Berlin 1919 (Sokrates, NF 7, 1919, Ergänzungsheft), 11-40, hier: 28.
[16] Die Besprechungen von Schulze, K.P., in: Wochenschrift für Klassische Philologie 11, 1894, Nr. 29/30, S. 796-798 und Magnus, Hugo, in: Berliner Philologische Wochenschrift 14, 1894, Nr. 27, S. 1163-1164 sind freundlich-zurückhaltend.
[17] Zum Beispiel: Zu den Carmina Latina Epigraphica, in: Philologische Wochenschrift 1930, S. 701-702 oder im Umfang von nicht einmal einer Druckseite (zum nachantiken Ursprung der Sentenz) Hic Rhodus hic salta, in: Das Humanistische Gymnasium 40, 1929, S. 220-221.
[18] Morgenstern, Otto: Vom Lateinlernen. Gedanken und Erfahrungen aus der Praxis besonders des Anfangsunterrichts. Berlin 1922 (S. 3 im Vorwort der Hinweis auf die Genese) - Anzeige von Grünwald, Eugen, in: Das Humanistische Gymnasium 34, 1924, S. 94: „dringend zu empfehlen“, etwas zurückhaltender ist Müller, Michael, in: Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen, 63, 1925, S. 344-345, der vor allem die umfangreichen lateinischen Sprechübungen skeptisch beurteilt und das Buch als Diskussionsstoff für die Referendarsausbildung empfiehlt.
Das mir vorliegende Exemplar aus der UB der Berliner Universität (seit 1946: Humboldt-Universität) enthält Ausleihstempel von 1925 an über die Jahre 1939 und 1940 bis zum 20. Juni 1944, es wurde also trotz des als Juden entrechteten Verfassers weder separiert noch gar ausgesondert.
[19] Morgenstern verweist im Vorwort (Anm. 18, S. 3) auf die Erfahrungen, die er seit 1908 nach der Reform des Mädchenschulwesens mit Lateinschülerinnen gemacht habe (welche Schule gemeint ist, wäre noch zu identifizieren, es könnte sich um das Steglitzer Kaiserin-Auguste-Victoria-Lyzeum gehandelt haben), und auf seine Tätigkeit in der Ausbildung der Studienreferendare.
[20] Nach den Angaben im Schulprogramm des Progymnasiums Groß-Lichterfelde (S. 42-43) hat Morgenstern im Schuljahr 1888/89 Latein und Deutsch in der Quinta und der Tertia unterrichtet (und zusätzlich in der Prima Hebräisch).
[21] Kley/Peitz äußern sich über diese Seite Morgensterns eher knapp, S. 15-18.
[22] Schwitzke, Heinz: Das einundzwanzigste Kapitel, Bielefeld 1980. Siehe die positive Besprechung von „E.St.“ in: Die Zeit, 14. November 1980. – Zu Schwitzke, der später als Leiter der Hörspielabteilung des NDR sich hohes Ansehen erwarb, siehe als Überblick den Wikipedia-Artikel, wo auch die frühe Mitgliedschaft in der NSDAP schon 1932 erwähnt ist (was für sein Verhältnis zu Morgenstern nicht unwichtig wäre, wenn er von dessen jüdischen Wurzeln gewusst hätte).
[23] Schwitzke legte Ostern 1926 in Lichterfelde das Abitur ab, siehe Festschrift (Anm. 46), S. 72, Nr. 667. Die beiden anderen im Roman genannten ehemaligen Schüler (Engelein, Auerswald) tragen augenscheinlich fiktive Namen, sie sind weder in den Namenslisten der Festschrift noch im Berliner Adressbuch identifizierbar).
[24] Die Festschrift (Anm. 46), S. 41 berichtet geradezu komplementär, dass anlässlich Morgensterns 60. Geburtstag im Jahr 1920 die Unterprima „eine griechische Aufführung der Antigone einstudiert“ hatte, „die eine geistige und künstlerische Leistung wurde“. Siehe auch Kley/Peitz, S. 17.
[25] Siehe Schwitzke (Anm. 22), S. 267, was bestätigt wird durch die Angaben in der Festschrift (Anm. 46), S. 90 sowie Morgensterns Beitrag zur Ruhegehaltsfrage (Anm. 12).
[26] Siehe eher knapp und oberflächlich Kley/Peitz, S. 32-33.
[27] Das wird besonders aus der von ihm verfassten Chronik des Philologischen Vereins in der Festschrift von 1919 (Anm. 14) deutlich. - Diese Festschrift umfasst neben einem Beitrag von Walter Amelung zu den Homerbildnissen (Amelung war zu dieser Zeit wegen der deutsch-italienischen Spannungen in und nach dem Ersten Weltkrieg aus Rom gekommen und an der Berliner Universität tätig) nur die Darstellung der Vereinsgeschichte (bereichert von Namenslisten) sowie einen Nachruf auf ein jüngst verstorbenes Mitglied. Programmatisches oder Beiträge zur Klassischen Philologie aus Schule oder Universität finden sich nicht. Der Festvortrag von Walter Kranz über „Gott und Mensch im Drama des Aischylos“ (vgl. die Mitteilung in der Wochenschrift für Klassische Philologie 37, 1920, Nr. 5/6, S. 71) ist separat veröffentlicht (Sokrates 8, 1920, S. 129-147).
[28] Dazu zuletzt Kranzdorf (Anm. 3), S. 95-98.
[29] Schwitzke (Anm. 22), S. 258 sieht in Morgenstern denjenigen, der die Tagung „maßgeblich mitverantwortet und großteils geleitet“ habe, was sicherlich über das Ziel hinausschießt und die Rollen beispielsweise von Jaeger und Kroymann ausblendet. Außerdem vermischt er die Tagungspublikation und das Festbüchlein „Flores Gymnasiales“.
[30] Morgenstern, Otto (Hrsg.): Das Gymnasium, Leipzig 1926.
[31] Burck 1987 (o. bei Anm. 2), S. 3.
[32] In der sehr ausführlichen Besprechung der Tagung durch Klatt, Willibald, in: Vierteljahresschrift für philosophische Pädagogik 6, 1924/25, S. 172-183, hier S. 182-183 heißt es über Morgensterns eigenen Beitrag, er berühre „bei aller Vortrefflichkeit“ die „besonderen Zwecke der Tagung“ nicht wirklich zentral (der Verfasser drückt es ausführlicher und höflicher aus); ähnlich ist der Tenor in Klatts weiterem Bericht in: Das Humanistische Gymnasium, 36, 1925, S. 127-136, hier: S. 135. – Das Thema der „Lehrerauslese“ trieb Morgenstern auch sonst um, so in seinem Referat über ein Buch Walther Borghius „Die Schule – ein Frevel an der Jugend“ vor der Berliner Gesellschaft für Wissenschaft und Erziehung (Bericht von Levinstein, Kurt, in: Deutsches Philologenblatt 39, 1931, S. 413).
[33] Siehe dazu die sorgfältige und einfühlungsreiche Darstellung von Mensching (Anm. 1), außerdem Sallmann, Klaus: Ein Hermaion als Nachtrag zur „Geschichte des DAV“, MDAV 1993/1, S. 14-17. Beide interessieren sich allerdings nicht für Morgenstern. - Digitalisat unter https://www.telemachos.hu-berlin.de/materialien/Flores_Gymnasiales.pdf
[34] Es enthält aber nicht die „Gedenkrede auf Herrn Professor Dr. Georg Matthaei“ (so Kley/Peitz, S. 34), die schon 1919 gehalten wurde und offenbar separat publiziert ist, aber Auszüge aus den Erinnerungen an die Schulzeit des ehemaligen Oberbürgermeisters von Berlin und Schöpfers von Groß-Berlin Adolf Wermuth, der nach seinem Rücktritt 1920 in Lichterfelde lebte; außerdem ein lateinisches Lobgedicht auf ihn anlässlich seines 70. Geburtstages.
[35] Siehe Mensching (Anm. 1), S. 18-19.
[36] Ob der als letztes Lied eingefügte Text ohne Verfasserangabe „‘s gibt kein schöner Leben / als das LEHRERLEBEN“ (die Umdichtung einer bereits 1907 im Kladderadatsch, Jg. 60, Nr. 48, Beiblatt unter dem Titel „Lehrers Lust“ erschienenen Parodie auf ein Studentenlied) von Morgenstern stammt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ist aber wahrscheinlich.
[37] Grünwald (Anm. 1), S. 136. In der Ankündigung der Tagung im Deutschen Philologen-Blatt 32, 1924, S. 373 ist dieser Termin noch nicht ausdrücklich genannt.
[38] Mitteilungen aus dem Deutschen-Altphilogenverbande, in: Das Humanistische Gymnasium 37, 1926, S. 120 (Morgenstern ist dort als „Oberstudienrat“, nicht als „Oberstudienrat i.R.“ bezeichnet).
[39] Bericht von Osten, Hermann, in: Das Humanistische Gymnasium 43, 1932, S. 52-54.
[40] Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbandes 1927/1, 9. – Kranzdorf (Anm. 3), S. 165, Anm. 102 hält Babick irrtümlich für den Vorsitzenden des Landesverbandes Pommern. Lt. Festschrift (Anm. 46), S. 94 war Babick seit Ostern 1926 Direktor des Schiller-Gymnasiums, davor „8 ½ Jahre“ des Sophien-Gymnasiums. Als Pensionist gab er an der Berliner Universität Latein- und Griechischkurse, siehe Brüssel, Marc: Altsprachliche Erwachsenendidaktik in Deutschland. Von den Anfängen bis 1945, Heidelberg 2018, S. 307.
[41] Der Nachruf seines Nachfolgers Fritz Sommer auf Kroymann (Anm. 7) lässt bei dem, was an Kroymann gelobt wird, aus heutiger Sicht eher schaudern.
[42] Vgl. die ebenfalls in den „Jüdischen Miniaturen“ erschienene Darstellung von Schlunke, Olaf: Eduard Norden. Altertumswissenschaftler von Weltruf und „halbsemitischer Friese“, Berlin 2016, bes. S. 44-51.
[43] Mensching, Texte von und über Eduard Norden (Anm. 4), S. 90, Festschrift Philologischer Verein (Anm. 15), S. 45, Nr. 88 sowie S. 29 mit der Nennung von fünf Vorträgen Nordens.
[44] Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 70 (1928), S. 216-217. – Die Festschrift (Anm. 46), S. 90 gibt als Amtszeit Ostern 1928 - Ostern 1934 an.
[45] Schlunke, Olaf, Eduard Norden zum 70. Geburtstag, Forum Classicum 2011/3, S. 194-199, hier: 196. – Außerdem ist Erwin Norden für 1918 in der Liste der Abiturienten des Schiller-Gymnasiums verzeichnet (Nr. 445, Festschrift [Anm. 46], S. 67).
[46] 50 Jahre Schillergymnasium zu Berlin-Lichterfelde 1885-1935. In Verbindung mit Professor Otto Morgenstern, Studienrat Dr. Gerhard Lindner und cand. theol. Martin Gern dargestellt von Dr. Eberhard Faden, Berlin-Lichterfelde 1935: Morgenstern war also nicht Herausgeber, wie Kley/Peitz, S. 34 schreiben. Auch kann nicht von „zahlreichen Beiträgen“ die Rede sein, lediglich die „Zusammenstellung über die Lehrer“ und ein lateinisch-deutsches Lobgedicht stammen von ihm – was für die Bedingungen des Jahres 1935 schon ziemlich viel ist. Erschienen ist die Festschrift im Selbstverlag (wie auch die Horaz-Stunde Morgensterns), die Firma J. Unverdorben ist in beiden Fällen nur als Druckerei, nicht als Verlag tätig (das hat z.B. Auswirkungen auf die Distribution und auch das wirtschaftliche Risiko).
[47] Kranzdorf (Anm. 3), S. 165 u.ö.
[48] In dem mir vorliegenden Exemplar der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung sind eine Reihe von Materialien beigegeben, die v.a. von Martin Gern (siehe unten Anm. 54) stammen, darunter ein Bericht des Steglitzer Lokal-Anzeigers über die Feier des 100-jährigen Schuljubiläums 1985, ein Brief Martin Gerns an die Ehemaligen sowie vor allem eine Kopie des Mitteilungsblatts des Vereins ehemaliger Steglitzer und Lichtenrader Gymnasiasten (Nr. 68, Oktober 1985) mit einer Schulchronik 1885-1945 ebenfalls von Martin Gern, die zwar wesentlich kürzer ist als die in der Festschrift, aber auch wesentlich nüchterner. Auch darin wird Otto Morgenstern mehrfach erwähnt, aber das sind so ziemlich die letzten Zeugnisse eines Gedächtnisses an ihn aus eigenem Erleben.
[49] Schwitzke (Anm. 22), S. 284.
[50] Morgenstern, Otto: Horaz und der Nationalsozialismus. Eine Unterrichtsstunde vor ehemaligen Schülern gehalten am 4. Mai 1935 in der Prima des Schillergymnasiums zu Bln-Lichterfelde, Berlin 1935.
[51] Kranzdorf (Anm. 3), S. 165-166.
[52] Morgenstern verteidigt Horaz gegen den Vorwurf von „maßgebender Seite“, ein „liberalistischer Epikureer“ zu sein. Es gibt dazu eine Parallele, den vor der Versammlung der Freunde des Humanistischen Gymnasiums in Magdeburg gehaltenen Vortrag von „Geheimrat Dr. Schmidt“ über „Horaz als Mensch und Dichter“ von Ende 1935, der nachweisen will, dass „der Freund des Mäcenas ‚kein liberalistischer Epikureer‘ gewesen ist“ (Bericht in: Das Humanistische Gymnasium 47, 1936, S. 171). Der Bezugspunkt scheint eine Äußerung des Preußischen Unterrichtsministers Rust vom 19. April 1933 zu sein (Deutsches Philologenblatt 41, 1933, S. 199, dort zitiert aus der Berliner Tageszeitung „Der Tag“): „Selbstverständlich liegt der Ton auf dem klassischen Griechentum, und gemeint ist nicht etwa die Kulturvermischung liberalistischer Spätepochen … in die Minister Rust übrigens (man atmet auf, das zu hören!) auch den Schulschreck Horaz einbezieht: ‚Es gibt keinen größeren Gegensatz zum Heroismus als diesen liberalistischen Epikuräer …‘“ – Dass Morgenstern und Schmidt diesen Gegner des Horaz nicht beim Namen nennen, hat also einen guten Grund.
[53] Vgl. ähnlich Hauser (unten Anm. 59), S. 2, der die Horaz von Augustus angetragene Position als „eine Art Propagandaminister“ modernisiert.
[54] Es sind zwei Reaktionen darauf überliefert. Schwitzke (Anm. 22), S. 284-285 sieht in der Unterrichtsstunde in der Erinnerung eine „Herzenseinfalt“ voll „naiver Genialität“. Der Theologiestudent und spätere Lichterfelder Pfarrer Martin Gern hatte als Zuhörer zunächst den Eindruck, die Verbindung von Horaz mit dem Nationalsozialismus sei ironisch gemeint (Kley/Peitz, S. 55). Doch ist zu bedenken, dass Gern zumindest später der Bekennenden Kirche nahestand und auch selbst Morgenstern als Lehrer nicht mehr erlebt hatte (er war Abiturjahrgang 1932). Es ist dies ein bemerkenswertes, aber wohl nicht repräsentatives Zeugnis, das zugleich zeigt, wie schmal der Grat war, auf dem sich Morgenstern bewegte.
[55] Die Festschrift (Anm. 46) liefert entsprechend ihrer Anlage darüber und auch über andere Feierlichkeiten beim Jubiläum keine Angaben.
[56] Zu Horaz hat sich Morgenstern philologisch zuvor allerdings nur punktuell geäußert, etwa in der Sitzung des Philologischen Vereins Berlin am 19. April 1920 mit einer Worterklärung in Hor. epist. 1,7,50 (siehe den Bericht in der Wochenschrift für Klassische Philologie 37, 1919/20, Nr. 27/28, S. 288.
[57] Siehe auch Roche, Helen: Classics and Education in the Third Reich: Die Alten Sprachen and the Nazification of Latin- and Greek-Teaching in Secondary Schools, in: Roche, Helen / Demetriou, Kyriakos (Hrsgg.), Brill’s Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany, Leiden 2018, S. 247 über Alfred Engelhardt, der 1942 seine Horaz-Interpretation mit Zitaten aus „Mein Kampf” unterfütterte.
[58] Hauser, Alfred: Die Oden des Horaz im Unterricht, in: Das Humanistische Gymnasium 47, 1936, S. 1-10 (geschrieben 1934). Zu Alfred Hauser und seiner zunächst affirmativen, später skeptischen Haltung dem NS-Staat gegenüber siehe Kuckenburg, Michael: „Daraus erwuchs bei uns Opposition“, in: Unterrichtspraxis 46,5, 2013, 1-7.
[59] Schaefer, Hugo: Horaz und Vergil im Dritten Reich, in: Das Humanistische Gymnasium 47, 1936, S. 204-209. – Siehe Ziolkowski, Theodor: Uses and Abuses of Horace: His Reception since 1935 in Germany and Anglo-America, in: International Journal of the Classical Tradition 12, 2005, 183-215, hier: 187-188 (mit kurzer Erwähnung von Morgenstern, Schaefer und weiteren wenig erfreulichen Beispielen). – Zu Hugo Schaefer (https://d-nb.info/gnd/1100364838) habe ich außer der Angabe der Lebenszeit (1888-1966) und des Berufs (Lehrer) sowie der Tatsache, dass er Briefpartner von Rudolf Borchardt war (Bestände im Deutschen Literaturarchiv Marbach - https://tinyurl.com/2r3fumkf), noch nichts gefunden.
[60] Zum weiteren Schicksal des Horaz in der NS-Bildungspolitik, wobei vor allem Hans Oppermann eine wichtige Rolle spielte, siehe Chapoutot, Johann: Der Nationalsozialismus und die Antike, Darmstadt 2014, S. 143-144 („Horaz als Kampfschriftsteller“).
[61] Das mir vorliegende Exemplar aus dem Archiv des Heimatvereins Steglitz ist handschriftlich dem „Amtsgenossen“ Eberhard Faden gewidmet, der auch die Festschrift (Anm. 46) betreut hatte.
[62] Die Erfahrungen, die Morgenstern schon in seiner Studienzeit mit dem Antisemitismus machen musste und die ihn zu einem der Gründungsmitglieder der Freien Wissenschaftlichen Vereinigung werden ließ (Kley/Peitz, S. 11-12; 51), waren seither vergessen oder verdrängt.
[63] Schwitzke (Anm. 22), S. 259 erwähnt die große Fülle solcher Gelegenheitsgedichte: „Jeder große Philologe Deutschlands - er kannte sie alle - hatte zum fünfzigsten, sechzigsten, siebzigsten Geburtstag oder zu andern Jubiläen ein Gedicht von ihm zu erwarten - erwartete es mit Stolz - ein Gedicht, dessen Inhalt mit der Eleganz der Form stritt.“
[64] Zu dieser merkwürdigen Gruppierung siehe Kley/Peitz, S. 36-47 (Morgenstern hatte dort auch schon andere, allerdings ausschließlich deutsche) Gedichte veröffentlicht. Die „BSG“ stand in keiner Weise für irgendeine subversive Tendenz.
[65] Dubielzig, Uwe: Die neue Königin der Elegien, Hermann Wellers Gedicht „Y“ (http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/GermLat/Acta/Dubielzig.htm - Abschnitt III) verweist darauf, dass in der Societas Latina sowohl NS-affirmative Texte als auch Texte von Juden publiziert wurden, sein Beispiel sind Texte des Julius Stern aus Baden-Baden, der sich der drohenden Deportation 1942 durch Selbstmord entzog und dessen letzte Texte postum 1943 gedruckt wurden – eine unausgesprochene und schwer zu generalisierende, aber verblüffende Parallele zu Morgenstern. Stern erhielt sogar einen Nachruf in der Novemberausgabe 1942 (abgedruckt bei Ruch, Martin: Kaddisch für Julius und Bertha Stern (Offenburg, Baden-Baden), Norderstedt 2015, 89). Vgl. Weise, Stefan: Mors interpres vitae. Dichten und Sterben des Humanisten Julius Stern (1865-1942) im Spiegel von Epikur, Petrarca und Erasmus, in: Weise, Stefan (Hrsg.), Litterae recentissimae. Formen und Funktionen neulateinischer Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Beiträge vom internationalen Symposium am 9. und 10. November 2017 an der Bergischen Universität Wuppertal, Innsbruck 2020, S. 177-204.
[66] Lurz war über die Berliner Verhältnisse zumindest in den 1920er Jahren gut informiert (das geht u.a. hervor aus seinem Beitrag „Die alten Sprachen und die Neuordnung des höheren Schulwesens in Preußen“, Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbandes 1927/2, S. 21-24), so dass daher ein Kontakt zu oder wenigstens ein Interesse an Morgenstern rühren könnte.
[67] https://periodica.pantoia.de/societas-latina/index.php#t2
[68] Auch eine solche, vergleichsweise kurze Untersuchung braucht Hilfe: Ich danke dem Archiv des Heimatvereins Steglitz für die unproblematische und postwendende Überlassung von Digitalisaten (vor allem der Horaz-Stunde Morgensterns) sowie Robin Beck und Myrto Ruppenstein für die wieder einmal bewiesene Findigkeit beim Aufspüren auch entlegener Literatur.
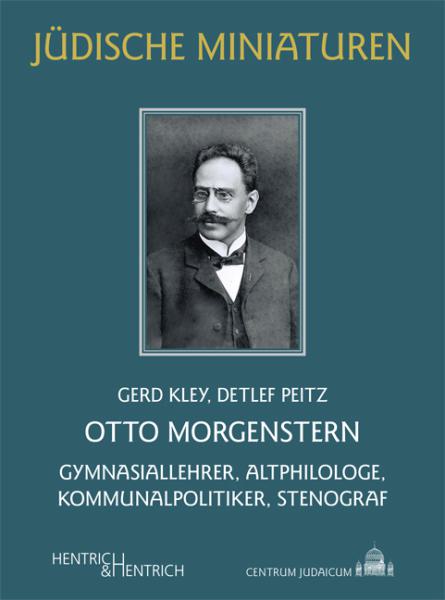
Juli 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Peter Schäfer, Die Schlange war klug. Antike Schöpfungsmythen und die Grundlagen des westlichen Denkens, München (C.H. Beck) 2022, 978-3-406-79042-3, 34,00 €
Woher kommt die Welt und welche Rolle spielt der Mensch darin? – Man kann sich wenige Fragen vorstellen, die epochenübergreifend von solcher Bedeutung sind. Der Judaist Peter Schäfer zeigt in seinem Buch, das eine wahre tour d’horizon durch die Geschichte des menschlichen Denkens vom Alten Orient über die Antike bis in die Neuzeit ist, wie stark sich vor Jahrtausenden angelegte Grundlinien nach wie vor durch unser Denken ziehen. Der Aufbau des Buches ist klar: Zunächst stellt Schäfer die beiden Schöpfungsberichte sowie der Erzählung von der Sintflut dar. Darauf folgen die altorientalischen Epen, die der auch in ihrer ungewöhnlichen Darstellungsweise bildhaft und präzise vor Augen führt, um sie dann der hebräischen Bibel gegenüberzustellen. Dabei rückt Schäfer, nötigenfalls philologisch fundiert, stets aber gut fasslich argumentierend, immer wieder verbreitete Missverständnisse zurecht – etwa, dass die hebräische Bibel eine creatio ex nihilo vertrete (39). Überrascht sein wird man auch, wenn der Auszug aus dem Paradies nach Schäfer nicht eine Bestrafung beschreibt, sondern eher einen Schritt in die Autonomie und Zivilisation (109–111). Es folgen Kapitel über Platon (Demiurg und Weltseele) und Aristoteles (unbewegter Beweger) – interessant hierbei sind die Unschärfen, die Schäfer herausarbeitet, und die Wechselwirkungen zur jüdisch-christlich-islamischen Denktradition. Wie glücklich die Einbeziehung der beiden Philosophen ist, zeigt sich dann auch im Kapitel über Philon von Alexandrien, die sich wiederum intensiv in seiner Deutung der biblischen Schöpfungsdarstellung von Platon beeinflusst zeigt. Ein nächstes Kapitel widmet Schäfer den mechanistischen Welt- und Kulturentstehungslehren der Atomisten – ausführlich und anregend kommt dabei Lukrez in den Blick. Das Kapitel über die rabbinische Schöpfungstheologie und die Auseinandersetzung mit der Rezeption der hebräischen Bibel (als Altes Testament) durch die Christen bietet gerade den von den klassischen Altertumswissenschaften Herkommenden interessante Einsichten. Das Schlusskapitel gestaltet Schäfer als Kulturgeschichte des Erbsündengedankens. Immer wieder sucht Schäfer die Engführungen herauszuarbeiten, die sich seines Erachtens, im historischen Durchblick, aus dieser Lehre ergeben – in seinem Epilog zieht Schäfer eine Verbindung zum berüchtigten Staatsrechtler Carl Schmitt (373–383). Ein weiteres beeindruckendes Beispiel für die ideologiekritische Wachheit, die Schäfers Buch charakterisiert, sind seine Ausführungen zum Bibel-Babel-Streit (69–81) – wie gern läse man das einfach nur mit historisch-distanziertem Amüsement als Charakterstudie des Wilhelminismus, doch allzu deutlich zeigen sich die Züge des später so verheerenden Antisemitismus. – Was Schäfer bietet, ist ein höchst anregender und kundiger Durchblick über die Kontinuitäten orientalischen und antiken Denkens bis in die Gegenwart. Gerade die judaistische Perspektive erweist sich dabei als lohnend und impulsgebend. Man bedauert, dass Schäfer die Kosmo- und Anthropogonie sowie die Sintflutstoffe in der antiken Mythologie (schön zusammengefasst im Artikel „Weltschöpfung“ des Neuen Pauly 12/2, 465–467) außer Betracht lässt – gerne hätte man gelesen, was Schäfer dazu Anregendes zu sagen gewusst hätte!
Stefan Freund
Juni 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
K.- W. Weeber, Schöner schimpfen auf Latein. Reclam: Ditzingen 2022. EUR 8,- (ISBN: 978-3-15-014308-7).
Wie in früheren Epochen so wird auch in unserer Zeit in vielen Bereichen beleidigt, geschimpft, polemisiert und denunziert. Vor allem in den Medien und sozialen Netzwerken gibt es ständig Verbalattacken gegen Mitmenschen, oft anonym, aber auch ganz offen. Dies war in der Antike nicht viel anders. Daher hat sich der bekannte Altertumswissenschaftler Karl-Wilhelm Weeber mit dieser Thematik näher auseinandergesetzt.
Bereits in der Einleitung (7-8) seines Bändchens geht er auf die Bereiche ein, in denen die Römer Schimpfwörter benutzten: auf Graffiti, auf Latrinenwänden, aber auch in der sogenannten hohen Literatur. Weeber informiert darüber, dass Schimpfwörter im schulischen Unterricht des Faches Latein so gut wie nicht vorkommen. Auf der anderen Seite stellen solche Begriffe einen selbstverständlichen Teil des römischen Alltagslebens „und römischer Zivilisation dar“ (8). Weeber will einer breiteren Öffentlichkeit die lateinischen Schimpfwörter vorstellen. Natürlich hat die Fachwissenschaft auch diesen Bereich der lateinischen Sprache ausgiebig untersucht und tut dies aktuell immer noch. So hat sich ein Sonderforschungsbereich (1285) an der Universität Dresden dieser Thematik (Invektivität) verschrieben. Weeber verweist auf einige wenige Publikationen zum Thema (I. Opelt, Die lateinischen Schimpfwörter und verwandte sprachliche Erscheinungen. Heidelberg 1965; Ph. Dubreuil, Le marché aux injures. Paris 2013; der Reclam-Verlag bietet als Download weitere Literaturhinweise). Für diejenigen Leserinnen und Leser, die sich intensiver mit dem anstehenden Sujet befassen wollen, sei auf weitere Veröffentlichungen hingewiesen (M. Wissemann, Schimpfwörter, https://www.telemachos.hu-berlin.de/latlex/s7.html; S. Koster, Die Invektive in der griechischen und römischen Literatur. Meisenheim am Glan 1980; G. Fink, Schimpf und Schande. Eine vergnügliche Schimpfwortkunde des Lateinischen. Zürich/München 1990). In der Linguistik gibt es in der Regel nur Umschreibungen des Begriffs Schimpfwort, aber noch keine allgemein anerkannte Definition. Ob außer Substantiven und Adjektiven auch Redewendungen als Schimpfworte anerkannt werden, ist umstritten. Reinhold Aman hat folgende Definition vorgeschlagen: „Jedes Wort, das aggressiv verwendet wird, ist ein Schimpfwort“ (Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch. Süddeutscher Verlag München 1972, 165). Weeber verweist auf die Listen im Buch von I. Opelt, „die sich je nach Kontext und Sprechintention als Schimpfwörter eigneten“ (S. 9f.). I. Opelt hat in ihrer Freiburg Habilitationsschrift folgende Definition vorgelegt, die sie auch in ihren zahlreichen weiteren Publikationen zum Thema zugrunde legt: „Das Schimpfwort ist die nominale prädikativische Feindanrede oder Feindbezeichnung normbezogen-negativen Inhalts, die in beleidigender Absicht geschieht und in der sich zugleich die Erregung des Schimpfenden löst“ (I. Opelt, a. a O., 18). Da Weeber sein Buch zur vergnüglichen Lektüre konzipiert hat und den Leserinnen und Lesern Spaß vermitteln will, in Anlehnung an einen Gedanken von Apuleius („intende, lector, laetaberis /Leser, pass auf, du wirst deinen Spaß haben!“ (Apuleius, Metamorphoses I 1,6) (Weeber, S. 8), mögen diese Gedanken zur Problematik einer Definition des Begriffs „Schimpfwort“ an dieser Stelle genügen.
Weeber versucht auf knappem Raum (128 S.) in 10 Kapiteln den Leserinnen und Lesern die wichtigsten Informationen mit zahlreichen Sprachbeispielen zu vermitteln. Den Titel des ersten Kapitels hat Weeber folgendermaßen formuliert: Vollpfosten, Schnarchliesen, aufgewärmte alte Knacker. Eine lateinische Schimpfwortkunde (9-24). Wie verbreitet der Gebrauch von Schimpfwörtern gewesen sein muss beweist die Tatsache, dass die Römer zahlreiche Begriffe für dieses sprachliche Phänomen verwendeten. Weeber nennt solche Lexeme auf den Seiten 10 und 11. Maledictum (Schmähung, Beleidigung) wurde häufig benutzt, convicium ist ein „Schimpfwort, das sich mit viel Geschrei und Zank verbindet“ (10), während man sich der Wörter probrum und opprobrium (beschimpfender Vorwurf) bediente, um auf einen konkreten Sachverhalt anzuspielen. Weeber führt des weiteren Begriffe wie contumelia (Schmach) und iniuria (Unrecht) an. Wenn jemand gleich mehrere Schimpfwörter gebrauchte, um über sein Gegenüber herzufallen, sprachen die Römer von impetus (Schimpfwort-Kanonade, 10). Falls die Positivform eines Adjektivs dem Redner zu gering erschien, verwendete er gerne auch den Superlativ/Elativ. Wenn spurcus (unflätig) nicht genügte, konnte spurcissimus (extrem schweinisch) die Attacke verstärken (10).
Eine sehr reiche Quelle für Schimpfwörter bieten die Komödien des Plautus, vor allem der Pseudolus und der Persa. Ein Auszug aus der zuerst genannten Komödie zeigt die große Vielfalt von Schimpfwörtern, die Plautus in den Gesprächen einbaut (11-13). Folgende drei Beispiele mögen dies belegen, jeweils im Vokativ: Sceleste (Verbrecher), legerupa (Gesetzesbrecher), fugitive (Drückeberger). Im weiteren Verlauf des Kapitels nennt und erläutert Weeber einige Bereiche, aus denen die Römer gerne ihre Schimpfwörter geschöpft haben. So bietet das Tierreich eine reiche Quelle. Beispielsweise verwendeten die Römer häufig das Schimpfwort canis (Hund/Hündin). Weeber belässt es nicht bei der Nennung des Begriffs, sondern liefert einige interessante Erläuterungen, damit der heutige Leser/die heutige Leserin das Schimpfwort besser einordnen kann. So verfährt Weeber auch in anderen Fällen. Weitere Bereiche, die eine Fundgrube für Schimpfwörter darstellen, sind etwa die Natur, der Mensch (vetula (alte Schachtel) oder decrepitus (abgeklapperter Tattergreis)), sexuelle ‚Perversionen‘ (impudicus (Lustmolch)), charakterliche Mängel (petulans (unverschämt)), das übermäßige Streben nach Reichtum und Besitz (avarus (Geizkragen) und vieles mehr.
Im zweiten Kapitel wendet sich Weeber dem politischen Bereich zu. Das Kapitel lautet: Du Verbrecher, Du Seuche, Du Schandfleck. Hatespeech in der Politik (25-49). Römische Redner nahmen in ihren Ansprachen kein Blatt vor den Mund und gingen zuweilen rücksichtslos gegen ihre Kontrahenten vor, ob vor Gericht, im Senat oder in der Volksversammlung. Weeber liefert einige Textbeispiele aus den Reden Ciceros und aus dem Werk des Sallust. Neben Marcus Antonius war Lucius Calpurnius Piso einer der ärgsten Widersacher des römischen Redners aus Arpinum, da er Ciceros Rückkehr aus der Verbannung hintertreiben wollte. In seiner gesamten Rede polemisiert Cicero gegen seinen Gegner, ja Feind: Quid enim illo inertius, quid sordidius, quid nequius, quid enervatius, quid stultius, quid abstrusius? – „Was gibt es für ein Subjekt, das fauler, dreckiger, nichtswürdiger, schlapper, dümmer und hinterhältiger sein könnte als dieser Kerl!“ (frg. 7, S. 29/30).
Ein weiteres interessantes Sprachfeld bieten die römischen Namen; Weeber erläutert die Bedeutung zahlreicher römischer Namen im dritten Kapitel: Dumme, Dicke, Schlappohren und Plattfüsse. Namen, die bezeichnen und zeichnen (50-58). Der berühmte Dichter der augusteischen Zeit Horaz hieß Quintus Horatius Flaccus, wobei das Cognomen ‚Schlappohr‘ bedeutet. In einem berühmten Prozess des Jahres 70 v. Chr. hielt Cicero Reden gegen den Statthalter auf Sizilien, Verres, das ‚Warzenschwein‘. Aufgrund seiner rhetorischen Glanzleistung in diesem Verfahren avancierte Cicero zum ersten Redner Roms. Der Redner, der erfolgreich sein wollte, musste bei der Wahl der Schimpfwörter versuchen, sein Publikum genau einzuschätzen, damit er nicht das Gegenteil von dem bewirkte, was er erreichen wollte. Weeber verweist auf eine wichtige Schrift Ciceros, nämlich de oratore, in der entscheidende Aspekte genannt werden, die berücksichtigt werden sollten (de orat. II 239). In den folgenden Kapiteln offeriert Weeber Hinweise auf Schimpfwörter, die auf Fluchtafeln zu finden sind (Kapitel 4: Macht ihn fertig, Dämonen! Aus der Welt der Fluchtafeln, 59-75), und auf solche, die diejenigen trafen, die es wagten, sich an einem öffentlichen Raum zu erleichtern (Kapitel 5: Cacator, cave malum. Warnung vor Wildpinkeln und Schlimmeres, 76-82). Das sechste Kapitel trägt den Titel: Der listige Chilon lehrte, leise zu furzen. Philosophische Latrinenparolen (83-86). Im siebten Kapitel stehen Schleudergeschosse im Vordergrund: Eicheln, die verletzen sollen. Schleudergeschosse als psychologische Kriegsführung (87-93). Die glandes, eichelförmige Bleigeschosse von 50 bis 70 Gramm, sollten die Gegner verunsichern und demoralisieren (87). Sie konnten aus großer Entfernung abgeschossen werden und Menschen empfindlich verletzen, sogar töten. Sie trugen entweder Symbole oder Sprüche, die sehr bösartig sein konnten. Einige dieser Schleudergeschosse sind erhalten, vor allem die aus dem Perusinischen Krieg (41/40 v. Chr.) weisen äußerst aggressive Sprüche auf. Das achte Kapitel widmet sich obszönen Schimpfwörtern: Futuere und co. Das lateinische F***-Wort und weiteres sexuelles Vokabular (94-104). Auf Graffiti in Pompeji geht Weeber im neunten Kapitel ein: Einblicke ins pralle Alltagsleben. Graffiti auf pompejanischen Wänden (105-117). Weeber leitet seine Gedanken mit einem selbstironischen ‚Spruch‘ ein, der dreimal überliefert wurde:
Admiror, paries, te non cecidisse ruinis,
qui tot scriptorum taedia sustineas.
„Ich bewundere dich, Wand, dass du noch nicht zusammengebrochen bist, / die du doch das blöde Zeug so vieler Schreiber aushalten musst.“ (105)
Während viele Graffiti im Lauf der Zeit zerstört wurden, haben sich zahlreiche Beispiele in Pompeji und Herculaneum wegen des Vesuvausbruchs im Jahre 79 n. Chr. erhalten. Die viele Meter hohe Ascheschicht hat die Häuser bedeckt, bis Archäologen sie ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wissenschaftlich ausgruben. Weeber stellt verschiedene Typen von Graffiti vor, mit zahlreichen Textbeispielen, die man auch im Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) nachlesen kann.
Im letzten und zehnten Kapitel liegt das Hauptaugenmerk auf den Carmina Priapea und auf der obszönen Hardcore-Poesie (118-123). Namenspate ist der Gott Priapus, dessen besonderes Merkmal ein erigierter Penis ist. Der Dichter Martial befasste sich thematisch mit dieser Gottheit in einigen Spottepigrammen. Ein anonymer Dichter des 2. Jahrhunderts n. Chr. hat ein ganzes Buch dem Gartengott Priapus gewidmet. Weeber hat einige Gedichte ausgewählt und mit Übersetzung abdrucken lassen.
Insgesamt bietet Weeber eine kurzweilige Lektüre für Leserinnen und Leser, die sich mit polemischen Ausdrücken/Lexemen in der Antike befassen möchten. Die Römer haben nicht nur große Dichter wie Horaz, Ovid und Vergil hervorgebracht, sondern auch Autoren und anonyme Verfasser von Texten, in denen zahlreiche Schimpfwörter die damaligen Zuhörer möglicherweise fasziniert haben. Ob eine Lehrkraft die Thematik im Unterricht behandelt, muss jede Lehrerin/jeder Lehrer selbst entscheiden.
Dietmar Schmitz
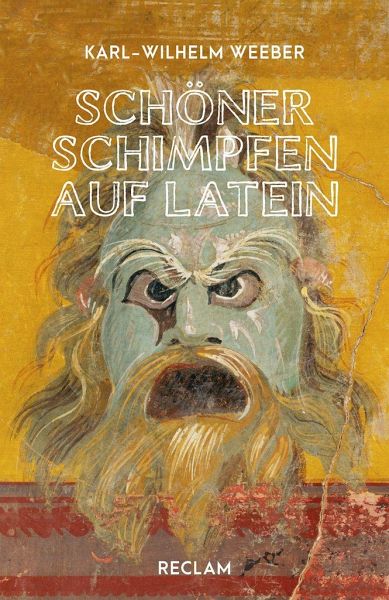
Editorische Richtlinien für das Forum Classicum
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
- Das Forum Classicum versteht sich ganz im Sinne seines Namens als einen Ort des Austausches.
- Im Zentrum steht der Dialog zwischen Universität und Schule. Dieser vollzieht sich insbesondere mittels fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Beiträge mit Bezug zu Unterrichtsthemen der Schule.
- Das Forum Classicum strebt eine möglichst große Diversität (z.B. Region, Alter, Geschlecht, beruflicher Status) der Autor*innen an. Die Mitglieder des Deutschen Altphilologenverbandes sollen sich in ihrer Breite repräsentiert fühlen.
- Diversität soll auch hinsichtlich der Inhalte erreicht werden: Diskussionen sollen gefördert werden. Deshalb sind Aufsätze stets willkommen, die Stellung zu früheren Beiträgen beziehen. So soll ein lebendiger Austausch entstehen. Von den Beiträger*innen wird Fairness gegenüber den anderen erwartet, aber auch die Leser*innen sind als mündige Bürger*innen dazu aufgerufen, einzelne Stellungnahmen eigenständig und kritisch zu hinterfragen.
- Die Auseinandersetzung mit anderen Autor*innen darf kritisch sein, muss aber respektvoll bleiben.
- Das Forum Classicum verfügt nur über eine begrenzte Kapazität hinsichtlich seines Umfangs. Deshalb ist gegebenenfalls eine Auswahl aus den eingegangenen Beiträgen nach den hier formulierten Richtlinien unumgänglich.
- Grundsätzlich kann innerhalb eines Jahres von einer Person nur ein Einzelbeitrag (Aufsatz mit Auflistung im Inhaltsverzeichnis) angenommen werden.
- Ein Beitrag, der beim Forum Classicum eingereicht wird, kann nicht zugleich einer anderen Zeitschrift vorgelegt werden.
- Für Beiträge mit Unterrichtsmaterialien sei auf die Pegasus-Onlinezeitschrift verwiesen
Mai 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Demandt, A., (2022) Diokletian. Kaiser zweier Welten. Eine Biographie. München 2022. 432 S. EUR 32,- (ISBN 978-3-406-787317).
Alexander Demandt hat zahlreiche Monographien und viele Aufsätze verfasst. Besonders hervorheben möchte ich drei Opera: Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken (München 1978), Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil der Nachwelt (München 1984) und: Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284–565 n. Chr. (Handbuch der Altertumswissenschaft, dritte Abteilung, sechster Teil). 2. vollständig bearbeitete und erweiterte Auflage (München 2007). Drei Biographien stammen aus seiner Feder, die erste zu Alexander dem Großen (Leben und Legende, München 2009), die zweite zu Pontius Pilatus (München 2012) und die dritte zu Marc Aurel (Der Kaiser und seine Welt, München 2018). Nun folgt eine weitere Biographie, nämlich die zu Kaiser Diokletian.
Bereits im Vorspruch (9-10) liefert Demandt außer den üblichen Dankesworten wichtige Hinweise auf die Einteilung der römischen Geschichte und damit auch Erklärungen für einen Teil des Titels seines Buches (übrigens nach Aussagen des Autors das dreißigste für das Verlagshaus Beck, 10). Nach Demandt gliedert sich die römische Geschichte in die Zeit der Republik und die Kaiserzeit. Die erste große Periode endet mit der Seeschlacht bei Actium 31 v. Chr., während die Kaiserzeit als die zweite Großperiode „nach der Diktatur Caesars (49-44) seit der Sicherung der Alleinherrschaft des Augustus (27 v. Chr. bis 14 n. Chr.)“ folgt (9). Nach der Severerdynastie (235 n. Chr.) wird die Zeit der Soldatenkaiser angesetzt, die „den Übergang zur Spätantike“ (9) darstellt und „damit die Kaiserzeit in die Phasen des Prinzipats und des Dominats“ (9) unterteilt. Die zuletzt genannte Phase beginnt mit Kaiser Diokletian im Jahre 284 (und Constantin 306) und endet im Westteil des römischen Reiches mit Romulus Augustulus (476). Demandt erkennt im Wirken Diokletians „eine doppelte Zugehörigkeit, auf eine Position als Kaiser zweier Welten“ (9). Er kann als letzter Soldatenkaiser und aufgrund verschiedener Aspekte als erster Kaiser der Spätantike betrachtet werden. Zu diesen Aspekten zählt Demandt die folgenden: „erfolgreiche Reformen, Verlagerung der Regierung von Rom an die Grenzen, den Hauptstadtwechsel, die Neugliederung der Provinzen und die Festschreibung des Hofzeremoniells“ (9/10). Damit sind entscheidende Themen bereits angeschnitten, die Demandt in seinem Buch ausführlich behandelt.
Demandt spricht im Falle des Kaisers Diokletian von Alleinstellungsmerkmalen im Vergleich mit anderen Herrschern der römischen Geschichte: ursprünglich stammt der Protagonist aus dem Sklavenstand, ihm gelang die Freilassung, der steile Aufstieg über den „Kriegsdienst und die Offizierslaufbahn zum Kaisertum war einzigartig“ (10). Unvergleichlich war die von Diokletian kreierte Viererherrschaft (Tetrarchie) von zwei Augusti und zwei Caesares, seine vergeblichen und letztmaligen Bemühungen, das Christentum zu eliminieren, da es nicht zur „gesamtantiken Religiosität“ passte (10), „die misslungene umfassende Preiskontrolle und die Abdankung nach einer geplanten Regierungszeit von zwanzig Jahren mit geregelter Nachfolge“ (ebenda).
In dreizehn Kapiteln versucht Demandt Leben, Wirken und Scheitern des Kaisers darzustellen. Ihm gelingt es in überzeugender Art und Weise, wichtige Stationen zu beschreiben und auch zu kommentieren. Dabei geht er zunächst ausführlich im ersten Kapitel auf die Quellen ein, die ihm als Forscher zur Verfügung standen (Die Quellen unseres Wissens, 13-20). Wie bei Demandt üblich, erläutert er präzise seine Vorgehensweise und auch die Begriffe, deren er sich bedient. So legt er eine Definition für den Terminus Quelle vor: „Eine Quelle ist das Ende eines Vorgangs und der Anfang seiner Erkenntnis“ (13). Dabei differenziert er zwischen zwei Typen von Quellen: einerseits die Historiographie und die Inschriften, andererseits die Gelegenheitsreden, Papyri und Münzen. Er betont auch, dass stets geprüft werden muss, ob die Quellen verlässlich sind und ob der Informationsgehalt stimmig ist. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Demandt nicht nur eine Biographie schreibt, sondern dass er immer darauf achtet, den Leserinnen und Lesern seine gewählte Methodik, die Aufgaben der Geschichtsschreibung und die benutzten Begriffe genau zu erläutern. Allein aus diesem Grunde ist die Lektüre dieses Buch allen Studierenden des Fachs Geschichte dringend empfohlen, da sie am Beispiel einer bedeutenden Herrscherfigur am Ende der Epoche der Soldatenkaiser und der beginnenden Spätantike wesentliche handwerkliche Zugriffsmöglichkeiten eines Historikers erkennen und erlernen können. Gut unterrichtet sind wir aufgrund der Quellenlage für die Zeit bis zum Jahr 229, etwa durch die Nachrichten eines Cassius Dio. Demgegenüber ist die Quellenlage für die Epoche der Soldatenkaiser und der Tetrarchie recht dürftig, da es keinen „erhaltenen zeitgenössischen Darsteller“ gibt (14). En passant erhält man als Leserin/Leser wertvolle Informationen über die Epochen vor und nach Diokletian. So verweist Demandt auf einen Textfund aus der Wiener Hofbibliothek des Jahres 2014, nämlich auf die <Scythica Vindobonensis> (15). Hierbei handelt es sich um Pergamentblätter, die der flämische Humanist Ogier Ghiselin von Busbeck 1562 nach Wien gebracht hat. Auf diese Weise entsteht ein dichtes Gewebe von Informationen um Diokletian, rückblickend bis in die griechische Geschichte, vorausblickend bis in unsere Zeit. Demandt verliert allerdings nie den Blick auf wesentliche Aspekte, auch wenn er zuweilen abzuschweifen scheint. Diese Exkurse sind aber sehr wichtig, um bestimmte Fakten besser einordnen zu können. Der emeritierte Berliner Professor für Alte Geschichte geht auf weitere Quellen ein (panegyrische Texte, solche der Kirchenväter, sowie von byzantinischen Autoren), die ich hier nicht alle auch nur benennen könnte. Dafür empfiehlt der Rezensent die aufmerksame Lektüre des gesamten Buches.
Im zweiten Kapitel (Die Anarchie unter den Soldatenkaisern, 21-36) geht Demandt auf das Ende der Severerzeit ein, liefert Informationen zu den ersten Soldatenkaisern, beschreibt den Tiefstand unter Gallienus in den Jahren 260 bis 268, um anschließend den Beginn einer Phase der Konsolidierung zu erörtern. Auch in diesem Kapitel ist der Historiker erfolgreich darum bemüht, sprachliche Erläuterungen zu den geschichtlichen Aspekten zu liefern. Im Zusammenhang mit dem Übergang von der Epoche des Prinzipats in die Spätantike sprachen Wissenschaftler von einer ernsten Krise des Reiches unter den Soldatenkaisern. Demandt bietet eine Erklärung für die Etymologie des Wortes Krise, nämlich abgeleitet aus dem griechischen Verb krinein/entscheiden (22). Er erinnert daran, dass die hippokratische Medizin das Wort krisis verwendet, wenn die Entscheidung anstand, „ob ein Patient stirbt oder überlebt“ (22). Es bestand durchaus die Gefahr, dass die Einheit des römischen Reiches verlorenging. Der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt hat später die geschichtlichen Krisen untersucht und einen vielbeachteten Abschnitt verfasst (in: Ders., Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1868, im Nachlass 1905 erschienen und in einer von Rudolf Marx erläuterten Ausgabe publiziert, Stuttgart 1978). In einer Anmerkung (4, S. 320) liefert Demandt weitere Literaturangaben zum Thema, was eine geschichtliche Krise „eigentlich“ ist. Man kann sich also mit den Interpretationen des Berliner Althistorikers begnügen, man kann aber intensiver die Sekundärliteratur prüfen und noch tiefer in die Thematik eindringen. Das dritte Kapitel trägt den Titel: Die Erhebung Diokletians 284/285, 37-52. Hier geht Demandt – wie es sich für eine Biographie gehört – auf die Herkunft, den Namen und die Familie des Kaisers ein. Der vollständige Name, der auch erklärt wird, lautet auf offiziellen Dokumenten: Imperator caesar caius aurelius valerius diocletianus pius felix invictus augustus pontifex maximus tribunicia potestate consul pater patriae proconsul. Die Quellen belegen, dass Diokletian aus Dalmatien stammte, sich im Heer hochgedient hat und auch Latein sprach. Dagegen waren seine Griechischkenntnisse spärlich, ja sie wurden sogar abfällig eingeschätzt (41). Während bis zu Caracalla die Geburtstage aller Kaiser bekannt waren, danach lediglich in Ausnahmefällen, kann man im Falle Diokletians nur das Geburtsjahr erschließen: 248 n. Chr. Diokletian stammte aus kleinsten Verhältnissen, obscurissime natus. An diesem Beispiel zeigt sich die Neigung Demandts, wenn möglich für deutsche Begriffe die lateinische Entsprechung zu bieten. Im weiteren Verlauf geht der Historiker auf zahlreiche Details von Namen, Familie und Umfeld Diokletians ein. Wichtig ist auch der Abschnitt über Nikomedien als Hauptstadt (50-52). Die Verlagerung des Hauptsitzes kann als erste bedeutende Maßnahme der Reformen Diokletians angesehen werden. Nach Rom kam der Kaiser nur einmal, nämlich 303 n. Chr. anlässlich seiner Vicennalien (52), als er sein zwanzigjähriges Regierungsjubiläum feierte.
Im vierten Kapitel (Das Experiment der Tetrarchie, 53-71) wird die besondere Herrschaftsform, die Diokletian erfunden hat, erläutert. Es gab aber Vorläufer, die als Kaiser nicht nur den eigenen Sohn als Nachfolger festgelegt haben, sondern wie Marc Aurel, der „seinen Adoptivbruder Lucius Verus zum gleichberechtigten Augustus und Mitherrscher“ auswählte (54). Die militärische Lage verlangte nicht nur einen Machthaber, sondern mindestens zwei. Daher war die Idee eines „regionalen Mehrkaisertum“ keine Neuerung, die Diokletian erfunden hätte (54). Demandt erklärt den Begriff ‚Tetrarchie‘ genau, der sich erst am Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzte (60). Bei Laktanz (MP.18,5) heißt es: ut duo sint in re publica maiores, qui summam rerum teneant, item duo minores, qui sint adiumento – „auf dass im Staat zwei Größere regierten, denen die höchste Entscheidung oblag, und zwei Kleinere zur Unterstützung“ (60). Bei Ammianus Marcellinus werden die Caesares als apparitores/gehorsame Gehilfen der Augusti bezeichnet (60). Auf den folgenden Seiten zeichnet Demandt die weitere Entwicklung der neuen Herrschaftsform nach, geht auf die Herkunft der Caesaren ein, erläutert die Aufgabenbereiche und prüft, wie die Tetrachie in der Kunst dargestellt wurde. Hier wie auch in anderen Fällen zieht der Historiker passende Bilddokumente heran. Wenn die vier Herrscher auch gleichberechtigt waren, so behielt sich Diokletian die Ernennung der Konsuln vor (66). Auch in den bildnerischen Darstellungen lassen sich feine Unterschiede erkennen: „In allen diesen Monumenten herrscht Gleichheit unter den Tetrarchen mit dezenten Rangunterschieden zwischen den Augusti und den Caesaren in der Platzierung und in der Größe“ (70). Im fünften Kapitel widmet sich Demandt den Kämpfen im Osten (75-99). Konflikte zwischen Ost und West gab es bereits in mythischer Zeit, sie wurden seit Herodot thematisiert. Demandt behandelt die Entwicklung in den verschiedenen Regionen, etwa die der Parther, Sarazenen oder Ägypter. Immer wieder nimmt er Rückblicke vor, gerne auch unter Verwendung lateinischer Begriffe, etwa wenn es um den Einzug (adventus, introitus) der Kaiser geht oder bei der Bezeichnung von Amtsträger, wie im Falle des Ammianus Marcellinus (protector domesticus,84). Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn es ein Register mit all diesen lateinischen Begriffen gäbe. Dies würde auch die große Bandbreite zeigen, in der sich Demandt bewegt.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Sicherung des Westens (101-122). Der Nord-Süd-Konflikt war in der Geschichte Roms stets gefährlicher als der Ost-West-Konflikt. Auch hierzu bietet Demandt einige Beispiele, damit man die Situation zur Zeit Diokletians besser einordnen kann. Mehrere Völker des Westens und die Auseinandersetzungen mit Rom stehen in diesem Kapitel im Fokus.
Der Reichsreform gilt das siebte Kapitel (123-156), während Geld und Wirtschaft im Mittelpunkt des achten Kapitels stehen (157-175). Die Leserinnen und Leser erfahren in beiden Kapiteln viele interessante Details über das Hofzeremoniell, über Insignien und die Titulatur sowie über die Staatsfeste. Immer wieder erläutert Demandt wichtige Begriffe, so zum Beispiel das lateinische Wort corona. Ebenso geht der Forscher auf die Geschichte des Throns ein und erklärt Bedeutung und Historie des Zepters (133). Auf diese Weise entsteht gewissermaßen eine Kulturgeschichte der Menschheit. Fehlen durften natürlich nicht Hinweise zur Gesetzgebung und Rechtsprechung. „Hunderte von Entscheidungen Diokletians gingen ein in den Codex Justinianus und damit ins Corpus Iuris Civilis, das die europäische Rechtstradition geprägt hat.“ (156). Während im Ostteil des römischen Reiches Griechisch die vorherrschende Sprache war, war Latein im Westteil die Sprache, die die Menschen verwendeten. Für den Bereich des Rechts und des Militärs gilt Latein als die Sprache im gesamten römischen Reich. Berytos/Beirut war das Zentrum des römischen Rechts, dort wurde Latein gesprochen und geschrieben. Im achten Kapitel erörtert Demandt Aspekte wie Prägestätte, Münzpropaganda, Steuern, Frondienste, Staatsausgaben und die Finanzlage insgesamt. In die Geschichte eingegangen ist der von Diokletian verfügte Maximaltarif, das Edictum de pretiis rerum venanium (167ff.). In der Regel scheiterten die meisten Versuche, Höchstpreise für Waren festzulegen. Wenn es ungünstig verlief, wurden die Waren einfach vom Markt genommen. Es gab sogar Stimmen, die meinten, die Finanzlage des römischen Reiches habe den Niedergang der antiken Kultur bedeutet. Peter Heather vertrat die Auffassung, dass man mit Geld Rom hätte retten können (174).
Aufschlussreich ist auch das neunte Kapitel, in dem die Christenverfolgung thematisiert wird (177-204). Demandt geht auf die verschiedenen Religionen im römischen Reich ein und beleuchtet die zehn Christenverfolgungen seit Nero. Die kirchliche Überlieferung nennt diese Zahl, während Demandt die Auffassung vertritt, dass es unter Diokletian die erste und einzige Christenverfolgung gegeben habe, „wenn man darunter, wie üblich, ein reichsweites Religionsverbot versteht“ (186). Diokletian hatte lange damit gezögert, solche Verfolgungen durchzuführen. Durch Laktanz sind wir über Beginn und Verlauf gut unterrichtet. Entscheidend war das Edikt, dass Kaiser Diokletian im Februar 302 erließ (191). Über seine Beweggründe kann man nur spekulieren. Demandt behandelt auch die Haltung der christlichen Autoren im Zusammenhang mit den Verfolgungen und den Widerständen gegen das Christentum (201-204). In den weiteren Kapiteln erläutert Demandt die Umstrukturierung des Heeres (Das neue Heer, 205-221), stellt die Bauten der Tetrarchen (223-255) vor, um dann die Umstände der Abdankung, des Todes und der Nachfolge (257-275) zu erörtern. Zum Abschluss werden die Leserinnen und Leser über die Rezeption informiert: Diokletian nach Diokletian (277-307).
Es gibt einige Anhänge zu verschiedenen Kapiteln (301-317), dann folgen die Anmerkungen (319-384), die Tetrarchen-Tabelle (385), die Stammtafel zur Tetrarchie (387-388), die Chronik (389-394). Daran schließen sich Karten an (396-397), Abkürzungen (399-400) und ein Literaturverzeichnis mit mehrfach angeführten Publikationen (401-411) sowie ein Abbildungsnachweis (413-414) und das Register (415-432), von Aachen bis Zypern.
Demandt hat nicht nur eine Biographie über Kaiser Diokletian vorgelegt, sondern liefert viele aufschlussreiche und interessante Details über die anderen Tetrarchen und über seine Konzeption von Herrschaft mit zwei Augusti und zwei Caesares. Dabei erfahren die Leserinnen und Leser zahlreiche Hintergrundinformationen zur gesamten römischen Geschichte mit Ausblicken in unsere Zeit. Demandt nimmt Rückblicke und Vorausblicke vor, um bestimmte Details besser verständlich zu machen. Dabei stützt er sich auf wichtige Quellen, so dass jede Leserin und jeder Leser sich gegebenenfalls selbst ein Bild machen kann über die vom Autor vorgelegten Beobachtungen und Thesen. Insgesamt ist die Lektüre anregend, nie langweilig, da die Texte flüssig geschrieben und die meisten wissenschaftlichen Belege in den Anmerkungen zu finden sind und daher die Lektüre der einzelnen Abschnitte nicht beeinträchtigt. Auch Bilddokumente und andere wichtige Quellen wie Münzen werden gut nachvollziehbar interpretiert. Das Buch gehört in die Bibliothek eines jeden/einer jeden, die sich für römische Geschichte interessiert, und wird mit Sicherheit zu einem Standardwerk avancieren.
Dietmar Schmitz
April 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Der Westfälische Frieden. Lateinisch/deutsch. Herausgegeben, übersetzt und mit Erläuterungen und einem Nachwort versehen von Gerd Flemmig. Ditzingen: Reclam 2021. 399 S., 14,80 €.
„′s ist Krieg! ′s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, / Und rede du darein! / ′s ist leider Krieg - und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein!“ Dieses berühmte „Kriegslied“ des Matthias Claudius aus dem Jahr 1778 spricht ebenso von der tiefen Sehnsucht nach Frieden in Zeiten des Krieges wie Immanuel Kants immer noch fundamentale Schrift „Zum ewigen Frieden“ (1795) oder Joseph Haydns Missa in tempore belli (1796). Dabei war doch schon eineinhalb Jahrhunderte zuvor der weltweite Friede ausgerufen worden nach den lange nachwirkenden, traumatischen Erfahrungen des Dreißigjährigen Kriegs (Herfried Münkler, Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618–1648, Berlin 2017) – der in Münster und Osnabrück verhandelte und geschlossene, auf unbegrenzte Dauer angelegte Westfälische Frieden von 1648.
Die Dokumente dieser Instrumenta Pacis hat nun Gerd Flemmig (den Besuchern der DAV-Kongresse als Leiter von Arbeitskreisen wohl vertraut) in einer handlichen und preisgünstigen Ausgabe zweisprachig verfügbar gemacht. Den Kern bilden selbstverständlich die beiden Verträge, der von Osnabrück mit den Bestimmungen für das Reichsgebiet, der von Münster mit den Bestimmungen über das Verhältnis zwischen Frankreich und dem Reich (jeweils mit einem Inhaltsverzeichnis versehen). Es beginnt mit der aufs Ganze zielenden Formulierung pax sit Christiana, universalis, perpetua veraque et sincera amicitia inter Sacram Caesaream Maiestatem, Domum Austriacam …, um dann sehr detailliert und kleinteilig voranzuschreiten und jede Region oder jeden Sachverhalt von Relevanz auch explizit zu regeln, z.B. (Art. 11, § 1)
Pro aequivalente autem recompensatione Electori Brandenburgico, Domino Friderico Wilhelmo, quod ad promovendam pacem universalem iuribus suis in Pomeraniam Citeriorem et Rugiam una cum ditionibus locisque supra annexis cesserit, praestanda, eidem eiusdemque posteris et successoribus, haeredibus atque agnatis masculis, cumprimis Dominis Marchionibus Christiano Wilhelmo, olim Administratori Archiepiscopatus Magdeburgensis, item Christiano Culmbacensi et Alberto Onolsbacensi eorundemque successoribus et haeredibus masculis, statim ac pax cum utroque Regno et Statibus Imperii composita et ratificata fuerit, a S. Caesarea Maiestate de consensu Statuum Imperii et praecipue interessatorum tradatur Episcopatus Halberstadiensis cum omnibus iuribus, privilegiis, regalibus, territoriis et bonis secularibus et ecclesiasticis, quocunque nomine vocatis, nullo excepto, in perpetuum et immediatum feudum. Constituatur item Dn. Elector statim in possessione eiusdem quieta et reali eoque nomine sessionem et votum in Comitiis Imperii et Circulo Inferioris Saxoniae habeat.
Als gleichwertige Entschädigung soll dem Kurfürsten von Brandenburg, dem Herrn Friedrich Wilhelm, weil er zur Förderung des allgemeinen Friedens auf seine Rechte in Vorpommern und auf Rügen einschließlich der dazugehörigen zuvor erwähnten Herrschaften und Orte für sich und seine Nachkommen, Nachfolger, Erben und männlichen Anverwandten, insbesondere für die Herren Markgrafen Christian Wilhelm, den einstigen Administrator des Erzbistums Magdeburg, sowie für Christian von Kulmbach und Albrecht von Ansbach sowie für deren männliche Nachfolger und Erben, verzichtet hat, sofort, sobald der Frieden mit beiden Königreichen und den Reichsständen geschlossen und ratifiziert worden ist, von der Kaiserlichen Majestät mit Zustimmung der Reichsstände und besonders der unmittelbar beteiligten das Bistum Halberstadt mit allen Rechten, Privilegien, Regalien, weltlichen und geistlichen Gebieten und Gütern, welchen Namen auch immer diese haben mögen, ohne Ausnahme als immerwährendes und unmittelbares Reichslehen übertragen werden. Ebenso soll der Herr Kurfürst sogleich in den ungestörten und tatsächlichen Besitz dieses Bistums eingesetzt werden und unter diesem Namen Sitz und Stimme auf den Reichstagen und im Niedersächsischen Kreis haben. Etc. etc.
Die Passage gibt auch einen Einblick in den lateinischen Duktus des Originals sowie des sachlichen Stils der Übersetzung. Da die Rechtssprache des 17. Jahrhunderts auch mit guten Kenntnissen der klassischen Latinität nicht immer unmittelbar verständlich ist, hat Flemmig ein eigenes erläuterndes Kapitel zu den sprachlichen Besonderheiten (291-303, hauptsächlich eine Wortliste) beigegeben. Das ist ebenso hilfreich wie die Anmerkungen und die Zusammenstellung von Begriffen, Verträgen und Ortsnamen sowie der an den Verhandlungen beteiligten Personen. Nur bei der Landkarte mit den Friedensschlüssen (364-365) kommt das Format eines Reclam-Heftes und der Graustufendruck an seine Grenzen, hier wäre ein zusätzlicher externer Link sinnvoll gewesen. Insgesamt ist aber auch diese Appendix sehr sorgfältig gearbeitet, auch kleinere Versehen sind selten (etwa S. 285, wo die den Jesuitenorden begründende päpstliche Bulle nicht „Regimini ecclesiae militaris“, sondern „Regimini militantis ecclesiae“ heißen muss – wohl nach F.M. Oertel, Die Staatsgrundgesetze des deutschen Reiches, Leipzig 1841, 309, Anm. 24 mit ähnlichem Duktus). Das Buch wird durch eine ausführliche, die Weiterarbeit ermöglichende Bibliographie beschlossen sowie durch ein Nachwort, das noch einmal Voraussetzungen, Kriegsverlauf, Ablauf und Inhalte der Verhandlungen sowie die Folgen knapp darstellt. Auch wenn nicht klar gesagt wird, wer die Zielgruppe ist, so lässt sich neben den allgemeininteressierten Lesern vor allem an den (vertieften) Geschichtsunterricht denken, aber auch für einen Ausflug in die Neuzeit im Rahmen des Lateinunterrichts ist ein Fundament gelegt, auf dem je nach unterrichtlicher Situation spezifisch aufgebaut werden kann.
Flemmig verzichtet auf vordergründige Aktualisierungen und überlässt es den Leser:innen, ihre eigenen gegenwärtigen Erfahrungen in historischer Brechung wiederzufinden – Erfahrungen, die seit dem 24. Februar 2022 eine bis dahin ungeahnte Nähe von Krieg und Hoffnung auf Frieden enthalten. Aber die Lektüre der Instrumenta Pacis zeigt auch, dass ein Friede sorgfältig ausgehandelt und gesichert werden muss, dass eben viele Details zu bedenken sind und dass es auch Instrumentarien geben muss, um die allseitige Einhaltung zu garantieren.
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

März 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Madeline Miller, Galatea. Erzählung, illustriert von Thomke Meyer, Madeline Miller, Galatea. Erzählung, illustriert von Thomke Meyer, München (Eisele) 2022, ISBN 978-3-96161-141-6, € 20,00
Pygmalions Geschichte ist, eingewoben in die tragische Erzählung des Orpheus, insbesondere durch Ovid bekannt: Die Erschaffung und Verwandlung der unvergleichlichen Statue in eine echte Frau mit Hilfe der Göttin Venus sowie die Eheschließung, die durch das Kind Paphos gesegnet wird, ist Thema einer Sage, die Orpheus nach dem erneuten und endgültigen Verlust seiner Eurydike preisgibt (Ov. met. 10,243–297). Während die Geschichte des antiken Dichters mit der Erwähnung der Empfängnis endet, beginnt Millers Kurzgeschichte nach einem weiteren Zeitsprung von zehn Jahren und gibt Galatea, dem einstigen Kunstwerk, neben ihrem Namen auch noch eine Stimme und einen starken Willen, um ihre Gefühle und Sicht der Ereignisse auszudrücken und nach ihren Interessen zu handeln. Wie in ihren anderen Werken („Das Lied des Achill“ und „ Ich bin Circe“) entsteht das W(underw)erk also durch einen deutlichen Perspektivwechsel. In ihrem Vorwort beschreibt Miller Pygmalion als Prototyp des Incel und macht bereits damit klar, was sie vom ursprünglichen Blickwinkel des Mythos hält. Gestärkt wird von ihr indes die feminine Willenskraft der Mütter, die keine Grenzen kennt. So befindet sich Galatea in der fingierten Fortsetzung des Mythos eingesperrt in ärztlicher Betreuung, da sie versucht hatte, gemeinsam mit ihrer Tochter dem lieblosen Pygmalion zu entkommen. Um ihrem Kind ein besseres Leben ermöglichen zu können, fasst Galatea einen Plan, den sie entschlossen und trotz aller eigenen Einbußen umsetzt.Das Opusculum wird mit einem Vorwort geziert, enthält für den eigenen Abgleich die Holzberg-Übersetzung der ovidischen Fassung und schließt mit einem Nachwort Knabls. Eine besonders künstlerisch ansprechende Gestaltung wird durch die in Blautönen gehaltene Illustration Meyers erreicht, die sowohl die Stimmung als auch das Ende der Geschichte zu unterstreichen sucht.
Anna Stöcker
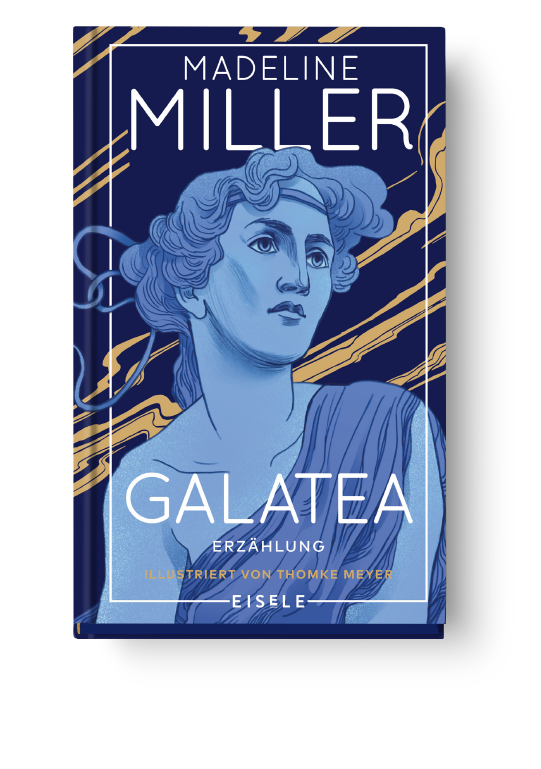
Februar 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Andreas Fritsch: Schriften
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/view/schriftenreihen/sr-77.html
Ce n'est pas un livre – es hätte aber eines werden können: In einer noch gar nicht so weit zurückliegenden Zeit war es akademischer Brauch, die „Kleinen Schriften“ eines Forschers noch einmal zwischen Buchdeckel zusammenzufassen und auf diese Weise wieder verfügbar zu machen, oder auch nicht: Denn diese Sammlungen fanden nur selten eine Verbreitung über die Sammelband-Abteilungen der universitären Spezialbibliotheken hinaus, die einzelnen Beiträge waren für Externe dann doch nur auf dem bisweilen recht bürokratischen Fernleihweg erhältlich.
Die Digitalisierung auch der Geisteswissenschaften hat – ein wenig im Verborgenen - neue Möglichkeiten geschaffen. Besonders für die Altertumswissenschaften hervorzuheben ist das Propylaeum-Projekt (https://www.propylaeum.de/), das von der UB Heidelberg und der Bayerischen Staatsbibliothek München getragen wird, und zu dem neben Bibliothekskatalogen, Datenbanken sowie dem Netzwerk recensio.antiquitatis auch eine elektronische Publikationsplattform (https://www.propylaeum.de/publizieren) gehört, die Buchpublikationen genauso einen Ort gibt wie ganzen Schriftenreihen oder – in unserem Fall relevant – die Wiederveröffentlichung von Zeitschriftenaufsätzen ermöglicht, die anders als etwa bei academia.edu nicht kommerziellen Interessen folgt.
Dafür zunächst einige Beispiele:
- Bucherstpublikation: Marc Brüssel, Altsprachliche Erwachsenendidaktik in Deutschland: Von den Anfängen bis zum Jahr 1945, Heidelberg: Propylaeum, 2018. https://doi.org/10.11588/propylaeum.369.522
- Buchzweitpublikation: Stefan Kipf, Altsprachlicher Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland: Historische Entwicklung, didaktische Konzepte und methodische Grundfragen von der Nachkriegszeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, Heidelberg: Propylaeum, 2020. https://doi.org/10.11588/propylaeum.618
- Publikationsreihe: Acta Didactica Classica. Bielefelder Beiträge zur Didaktik der Alten Sprachen in Schule und Universität, https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/series/info/adclass
- Zeitschriften: Forum Classicum - https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fc/index
sowie die Vorgängepublikation „Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbands“: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mdav%20
Andreas Fritsch (geb. 1941) muss kaum vorgestellt werden. Als Berliner Lehrer, Professor an der Pädagogischen Hochschule und dann an der Freien Universität (eine Reihe von Jahren auch für Humboldt-Universität zuständig) und nicht zuletzt seit 1991 als Redaktor der MDAV und des Forum Classicum hat er über viele Jahre oder besser: Jahrzehnte die altsprachliche fachdidaktische Diskussion mitgeprägt. In dieser Zeit sind zahlreiche Beiträge entstanden, die heute noch relevant, aber nicht leicht an ihren Originalpublikationsorten aufzufinden sind (vgl. https://www.klassphil.hu-berlin.de/de/personen/fritsch).
Nun lassen sich aber die Digitalisate von aktuell (Stand Mitte Januar 2023) von neunzehn dieser Publikationen bequem lesen (weitere Veröffentlichungen scheinen geplant). Die Reihe beginnt mit einem langen Aufsatz, in dem sich Bildungsgeschichte und aktuelle didaktische Fragen verbinden, nämlich zu „Sprache und Inhalt lateinischer Lehrbuchtexte. Ein unterrichtsgeschichtlicher Rückblick“ Nr. 1, 1976), worin – das ist typisch für Fritsch – der Blick auf die Tradition seit der frühen Neuzeit (immer wieder erscheinen Comenius und Gedike) als Maßstab für die aktuelle Praxis dient. Auch wenn seither mehrere Lehrbuchgenerationen ihren Weg in die Schulen und auch wieder heraus gefunden haben, so sei dieser Text allen Verfassern von Lateinbüchern ans Herz gelegt (und natürlich auch den Verlagsverantwortlichen). Mit der Geschichte des altsprachlichen Unterrichts befassen sich auch Nr. 10 (zu Wilamowitz), 28 (Zeittafel zum altsprachlichen Unterricht in Berlin von 1945 bis 1990), 29 (40 Jahre DAV Berlin), 48 (Comenius) sowie 49 und 52 (zu Gedike).
Einer von Fritsch‘ Lieblingsautoren ist Phaedrus, dem er sich in Nr. 16, 25 und 30 in unterschiedlichen Facetten nähert. Dass Latein nicht nur geschrieben, sondern auch gesprochen gehört, hat Fritsch in zahlreichen officinae Latinae auf den DAV-Kongressen und darüber hinaus immer wieder mit Nachdruck vertreten. Nachlesen kann man diese Position in Nr. 13, 33 und 44. Konkret der (zur Entstehungszeit) aktuellen fachdidaktischen Debatte wendet sich Fritsch in Nr. 34, 38 und 40 zu.
Schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich in der keineswegs beliebig bunten, aber abwechslungsreichen Reihe auf Schritt und Tritt lohnende Anregungen zum Nach- und Weiterdenken (wieder)entdecken. Wer beispielsweise den kleinen Aufsatz über die „Antike im Spiegel Berliner Straßennamen“ gelesen hat, wird künftig bewusster durch diese Stadt gehen.
Diese Sammlung der Schriften von Andreas Fritsch zeigt auch exemplarisch, wie die Digitalisierung dazu beitragen kann, dass einmal Geschriebenes aus dem kollektiven Gedächtnis nicht so leicht verschwindet. Denn die Beiträge sind (wie alle vergleichbaren Sammlungen bei Propylaeum) nicht nur über die Suchfunktion oder als Katalog auffindbar, sondern auch über die einschlägigen Suchmaschinen zu ermitteln: Quod non est in Google, non est in mundo – dem ist hiermit Rechnung getragen.
Ulrich Schmitzer, HU Berlin
Januar 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Wolfgang Will, Der Zug der 10 000. Die unglaubliche Geschichte eines antiken Söldnerheeres, München (C.H. Beck) 2022, ISBN 978-3-406-79067-6, € 28,00
In den Jahren 401 bis 399 nimmt Xenophon an einem Zug von 10.000 griechischen Söldnern teil, die in einem Streit um den persischen Thron der Jüngere Kyros gegen seinen Bruder Artaxerxes II. anwirbt. Aus eigenem Erleben schildert Xenophon später in seiner Anabasis, wie die Truppe zur Schlacht bei Kunaxa im Zweistromland zieht, wie sie dort einen Sieg erringt und zugleich den Tod ihres Anwerbers verschuldet, wie sie sich unter hohen Verlusten, unter Kämpfen und Plünderungen ihren Rückweg aus Babylonien über das Schwarze Meer nach Griechenland bahnt. – Wolfgang Wills Buch folgt der Anabasis in bemerkenswerter Weise: Nach einer kurzen Einführung in die Biographie des Verfassers, die eng verbunden ist mit den politischen Wirrnissen in Athen am Ende des Peloponnesischen Krieges, folgt Will der Darstellung des Xenophon: Er gibt sie wieder, ordnet sie historisch ein, erläutert und illustriert sie – auch durch Skizzen und Karten. Schon dieses Konzept der Wiedergabe eines bei unmittelbarer Lektüre zwar reizvollen, aber doch in vielem der Kommentierung bedürfenden Werkes, ist reizvoll und bietet einen höchst ansprechenden Lesestoff: Man erhält Einblicke in die politischen, militärischen und ökonomischen Aspekte des Krieges in der Antike – und in dessen allgegenwärtige Brutalität, die sich nicht nur in Kämpfen und Eroberungen, sondern auch in Versklavung und Vertreibung, dem Raub der Lebensgrundlagen und der Zerstörung der Infrastruktur niederschlägt. Es konkretisiert sich Bedeutung von angewandter Rhetorik und Manipulation, sowohl innerhalb des griechischen Söldnerverbandes, aber auch gegenüber Gegnern und Verbündeten. Es scheint die ethnische, sprachliche und kulturelle Pluralität des Perserreichs ebenso auf die wie Konflikte innerhalb des heterogenen griechischen Heeres, in dem weniger ein panhellenischer Gedanke als vielmehr die Einsicht, dass nur ein gemeinsamer Rückzug erfolgversprechend ist, die Konflikte und das Misstrauen zwischen Athenern, Spartanern und anderen überdeckt. Auch das Erleben von Natur und Wetter, von Flora und Fauna, wie es sich bei Xenophon findet, gibt Will wieder. Doch folgt der Althistoriker hier nicht nur klug erläuternd Xenophon, er hinterfragt auch dessen Darstellung: So rückt sich der Aristokrat immer wieder selbst ins rechte Licht dessen, der vom bloßen Begleiter des Zuges zum fähigen Anführer heranreift, er greift Topoi aus der Heimkehrergeschichte schlechthin, der Odyssee, auf und er wird – und das besonders schlagende Zusammenhänge – in seiner Selbstdarstellung immer wieder zum Vorbild Caesars. An keiner Stelle unterliegt Will der Versuchung, eine bloße Abenteuergeschichte zu erzählen, worin aber für ein antikes Publikum der Reiz der Anabasis liegen musste, leuchtet einer modernen Leserschaft unmittelbar ein. Bei all dem verliert Will aber nie den analytischen Blick des Althistorikers. Die Mischung aus wissenschaftlicher Differenzierung und flüssiger Lesbarkeit entlang der Anabasis lässt so ein gelungenes Buch entstehen.
Stefan Freund
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dezember 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Eleanor Dickey, Latein lernen wie in der Antike. Latein-Lehrbücher aus der Antike. Aus dem Englischen übersetzt von Marion Schneider, Basel (Schwabe Verlag) 2022, ISBN Printausgabe 978-3-7965-4088-2, ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4645-7, 22,00 Euro
In Witzesammlungen der 1970er Jahre fand sich der folgende: „Was hatten die alten Römer uns voraus? – Sie brauchten nicht Latein zu lernen.“ Es gehört zum Charme des hier vorgestellten Werkes, dass diese vermeintlich banale Alltagsweisheit hinterfragt wird: Auch in der Antike und von Römerinnen und Römern wurde Latein erst gelernt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Bewohner der östlichen Reichshälfte, für die Erstsprache oder alltägliche Lingua franca Griechisch war, die aber für Aufgaben in der Verwaltung oder im Heer, für eine Tätigkeit als Kaufmann oder im juristischen Bereich Lateinkenntnisse benötigten. Dafür entstand in der Antike eine Reihe von Materialien, die Eleanor Dickey in der angenehm zu lesenden Übersetzung von Marion Schneider hier einleitet und in Auswahl präsentiert. Die Einleitung beantwortet die Fragen nach den Lernenden (dem zwar wissenschaftlich stets fundierten, aber didaktisch orientierten Grundduktus des Buches käme es entgegen, hier noch biographisch fassbare Beispiele zu ergänzen – ob der Apostel Paulus als civis Romanus, der sich dem Rezensenten aufdrängt, ein schülernahes Exempel wäre, sei dahingestellt), nach der Methodik (durch bilinguale Texte, wobei Grammatiken auch für Anfänger einsprachig Lateinische waren, was wohl nur bedingt funktionierte – siehe S. 20), nach den Überlieferungswegen (Papyri und Handschriften ergänzen einander – in der indirekten Überlieferung sind die Hermeneumata von besonderem Interesse) und nach der Auswahl, in der der Hauptteil des Buches diese Texte bietet. Dieser nämlich enthält eine Sammlung von Texten aus antikem Lehrmaterial. Dabei wird so verfahren, dass die für die Lernenden verständlichen griechischen Passagen in deutscher Übersetzung wiedergegeben sind, das Lateinische (auch das nur Lateinische) lateinisch. Die Textauswahl beinhaltet Kolloquien, also sprachführerartig zweisprachig gestaltete Alltagsszenen, aber auch solche aus dem juristischen und mythologischen Bereich, Anekdoten oder Fabeln, Ausschnitte aus der Aeneis, Musterbriefe und eine Sallust-Kommentierung), Ausschnitte aus grammatikalischen Werken (Dositheus, schon in der Antike in Auswahl zweisprachig geboten, und Charisius, hier nur lateinisch geboten) Glossaren (hier in ausgewählten Beispielen nach Wortfeldern, zum Beispiel zum Theater), ein Zeugnis von Stilübungen (ein Übersetzungsversuch einer Babrius-Fabel vom Griechischen ins Lateinische), Alphabete (oder die Versuche dazu – hier ist nun das Griechische der Papyris-Vorlage übernommen, also Α βη κη δη η εφ γη usw.) und transliterierte Texte (das liest sich dann so: Σι ομνης βιβεριντ, τεργε μενσαμ. – dazu kommt dann die deutsche Übersetzung des ‚lateinischen‘ Textes, dieser selbst nicht, also beispielsweise auch: er sieht – ουιδετ). Im letzten Teil des Buches werden zweisprachige Texte (wie in den Kolloquien, also Alltagsszenen und mythologische Text usw., aber auch Ausschnitte aus der Grammatik des Dositheus und Glossare) mit dem griechischen Original (also nicht, wie vorher, mit der deutschen Übersetzung) gegenübergestellt, am Ende sind noch, eingeleitet durch ein deutsches Beispiel (LEISERIESELTDERSCHNEE), Texte ohne Worttrennung geboten, die die Schwierigkeit der Scriptio continua erkennen lassen. Am Ende steht eine Übersicht über die antiken Texte zum Lateinlernen, aus der die hier vorgelegte Auswahl schöpft, sie ist chronologisch geordnet und reicht vom 1. bis zum 7. nachchristlichen Jahrhundert. Das Buch entspringt der vorzüglichen Idee, einen Blick auf das antike Lateinlernen in den griechischsprachigen Regionen des römischen Reichs zu werfen. Das kann in vielen Zusammenhängen anregend und hilfreich sein: Es lässt die Bedeutung des Lateinischen als Sprache eines gewaltigen Raumes erkennen, der weite Teile Europas, Afrikas und Asiens umfasst, es bietet eine kommentierte Quellensammlung zu einem wenig beachteten Bereich antiker Bildungs- und Schulgeschichte, es lenkt wiederum den Blick auf die Mehrsprachigkeit und damit die ethnische und kulturelle Diversität des römischen Reichs, es ermöglicht Einblicke in die antike Didaktik(in der offenbar der Sprachvergleich ein wesentliches Moment war) und regt ein grundsätzliches Nachdenken über die gegenwärtige an, es ergänzt die immer wichtiger werdende (kritische!) Lehrbuchforschung sozusagen nach vorne und macht ganz nonchalant die 2000-jährige Geschichte des Lateinunterrichts manifest, es bietet Anstöße zu Lehrbuchtexten gerade für die Anfangsphase, die so, also auf antiken Vorlagen fußend, etwas weniger anachronistisch geraten könnten. Dem dank zahlreicher Sponsoren (siehe S. 4 – unter ihnen der Schweizer Altphilologenverband) erfreulich preisgünstigen Buch sei eine zahlreiche Leserschaft gewünscht. Man wird es schwerlich ohne frappierende, horizonterweiternde oder schlichtweg amüsante Erkenntnisse und Einsichten über das Lateinlernen und ‑lehren aus der Hand legen.
Stefan Freund
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

November 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Späth, Th. (Hrsg.) (2021), Gesellschaft im Brief. Lire la société dans la lettre. Ciceros Korrespondenz und die Sozialgeschichte/La Correspondance de Cicéron et l’histoire sociale. Collegium Beatus Rhenanus Bd. 9. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 430 S., EUR 72,- (ISBN 978-3-515-13095-0).
Die annähernd 1000 Briefe an und von Cicero bilden ein besonderes Quellenkorpus. Über keine andere Person der Antike gibt es mehr Selbstzeugnisse, die immer wieder Gegenstand der Forschung waren und sind. Vor allem im 19. Jahrhundert wurden die Aussagen in den Briefen Ciceros Textstellen aus anderen Schriften desselben Autors gegenübergestellt und vermeintliche Defizite und Umstimmigkeiten konstatiert. Die Verfasser der Beiträge des zu rezensierenden Bandes wählen einen anderen Zugriff auf die Interpretation der Briefe Ciceros. Im ersten Beitrag (Sozialgeschichte und Ciceros Korrespondenz als Chronotopos, 9-25) versucht der Herausgeber des Bandes, Thomas Späth (S.), in knappen Strichen die Zielsetzung des Buches zu beschreiben. Die Besonderheit liegt darin, dass sich 2009 ungefähr „dreißig AlthistorikerInnen, ArchäologInnen und PhilologInnen (…) der Universitäten Basel, Bern, Freiburg i. Br., Mulhouse und Strasbourg an einer Tagung des Collegium Beatus Rhenanus mit sozialhistorischen Forschungstraditionen auseinander“ (10) gesetzt haben. Daraus entwickelte sich ein Forschungsprojekt, aus dem mehrere Publikationen entstanden. Das Projekt trägt den Titel: „Sozialgeschichte und histoire culturelle: Perspektiven einer neuen römischen Sozialgeschichte – Sozialgeschichte et histoire culturelle: vers une nouvelle histoire sociale de l’Antiquité romaine“ (10). S. erinnert daran, dass die historisch-anthropologischen Ansätze, die seit mehr als sechs Jahrzehnten in Frankreich, Deutschland und Italien existieren, keinen Niederschlag in der traditionellen Sozialgeschichte gefunden haben. Es werden weitere Defizite und Desiderate genannt, an denen das Projekt ansetzt. Betont wird, dass es zu einem produktiven Austausch von Wissenschaftlern verschiedener Länder mit verschiedenen Forschungstraditionen kommt. S. macht darauf aufmerksam, dass der Ausgangspunkt der Analysen der beteiligten Forscher „die gesellschaftlichen Praktiken sind, die auf durch sie konstituierte Gruppierungen von Akteuren genauso wie auf Beziehungen unter ihnen hin ausgewertet werden; diese Praktiken sind in ihren situativen Dispositionen (d. h. in Räumen wie domus oder urbs, historischen Sachlagen wie Konflikten oder Gewalt, kollektiven Rahmen wie Familie oder politischen Strukturen) zu erfassen und auf ihre materiellen und symbolischen Bedingungen (ökonomische und ökologische Voraussetzungen, kollektive Vorstellungen von Identität, Vergangenheit, Geschlecht) zu prüfen“ (11). Die als abstrakte Untersuchungsanlage erarbeitete Matrix wurde von verschiedenen Forschern auf die Briefe Ciceros angewandt. S. erläutert ebenfalls, warum sich gerade das Briefkorpus des berühmten römischen Redners anbot (12-13). Der neue Zugriff auf die Korrespondenz Ciceros kann nach Aussagen von S. „den Blick auf die Zusammenhänge gesellschaftlicher Praktiken öffnen“ (13). Die am Projekt beteiligten Wissenschaftler „formulieren den literaturtheoretischen Begriff des Chronotopos neu für“ ihre „historische Problemstellung“ (14). Des Weiteren stellt S. kurz die drei Kapitel und ihre jeweiligen Beiträge vor. Am Ende des einführenden Aufsatzes finden sich wichtige bibliographische Hinweise, genauso wie es bei den anderen Essays praktiziert wird. Der zweite Beitrag im Einführungsteil stammt von Jürgen von Ungern-Sternberg, der auf die Leistungen von drei Forschern eingeht, die wichtige Stationen in der Tradition der Sozialgeschichte darstellen, nämlich die wissenschaftlichen Leistungen von Gaston Boissier, Matthias Gelzer und Eugen Täubler (Drei Beiträge zu einer römischen Gesellschaftsgeschichte, 27-58). Diese Ausführungen sind sehr lesenswert und informativ, so dass die Leserinnen und Leser die großen Traditionslinien der Sozialgeschichte besser einordnen und auch die neuen Ansätze des Projekts begreifen können.
Danach folgen die drei Kapitel, die jeweils aus vier Beiträgen bestehen. Das erste Kapitel trägt den Titel: Nouveaux objets – Forschungsgegenstände (61-158), das zweite ist folgendermaßen überschrieben: Nouveaux problèmes – Problemstellungen (161-250), die Überschrift des dritten Kapitels lautet: Nouvelles approches – Ansätze (251-402). Am Ende des Buches gibt es Informationen über die Autorinnen und Autoren (403-405), über die Textausgaben, Übersetzungen und Referenzen (407-408); daran schließen sich der Index locorum (409-424) sowie der Index nominum an (425-430). Im Rahmen dieser Rezension ist es nicht möglich auf alle Beiträge näher einzugehen. Daher habe ich einige wenige Aufsätze ausgewählt, die ich einer genaueren Betrachtung unterziehe.
Im ersten Kapitel befassen sich die Analysen mit dem Bild, das Cicero im Briefwechsel mit seinen Partnern bezüglich seiner politisch-gesellschaftlichen Stellung von sich selbst entwirft. Gemäß den Vorgaben des Chronotopos steht die Situierung in Räumen und in der Temporalität „um den metaphorischen Raum der magistratischen Aufgaben im konkreten Raum der Provinz, um die Bedeutung des urbanen Raums, aus dem das Exil den Protagonisten ausschließt, um die Handlungsräume aristokratischen Wohnens und um Beziehung dieser Räume mit der Temporalität der Spannung zwischen Gegenwart und Vergangenheit“ (16) im Vordergrund. Im ersten Beitrag, der aus der Feder von Marianne Coudry (C.) stammt, werden Briefe aus den Jahren 51-50 v. Chr. behandelt, als Cicero Statthalter von Kilikien war; in diesen Briefen konstruiert Cicero das Bild eines exemplarischen Statthalters (La construction de la figure du gouverneur exemplaire, 65-73). Bei der Erstellung eines Selbstbildes ist dem Verfasser der Briefe offensichtlich sehr bewusst, dass neben den „eigentlichen“ Adressaten wie Atticus, Appius Claudius Pulcher, sein Vorgänger im Amt, und die Senatoren „die sekundären Rezipienten zu den impliziten LeserInnen des Schreibenden gehören“ (16); auf diese Weise gelingt es dem homo novus, seine Stellung im sozialen Feld der Senatsaristokratie darzustellen. C. formuliert folgendermaßen, bezogen auf den Brief fam. II 13,2 (81): « Tant le contenu que le ton de cette lettre sont strictement semblables à ceux des lettres que Cicéron adresse lui-même à Appius, et cela laisse penser qu’elle n’était pas destinée au seul Caelius, mais aussi à Appius et sans doute à un cercle plus large, qu’il fallait convaincre du souci qu’avait Cicéron de conserver l’amitié de son prédécesseur » (Sowohl der Inhalt als auch der Ton dieses Briefes sind den Briefen überaus ähnlich, die Cicero selbst an Appius adressiert hat, und dies lässt daran denken, dass der genannte Brief (fam. II 13,2) nicht nur an Caelius gerichtet war, sondern auch an Appius und zweifelsohne an einen größeren Kreis, den er von der Sorge überzeugen musste, die Cicero damit hatte, die Freundschaft zu seinem Vorgänger zu bewahren). Nach C. führt dieses Beispiel zu der Frage der Verteilung dieser Briefe; sie ist davon überzeugt, dass sie in zahlreiche Hände gelangten und mehrmals kopiert wurden. Sie hat den Eindruck, dass man sich in einem Netzwerk befindet, in dem Informationen ausgetauscht wurden, das aber für uns heute weitgehend nicht greifbar, ja sogar hermetisch verschlossen ist (81).
Von großem Interesse sind auch die Ausführungen von Laura Diegel (Selbstbildnisse eines Exilierten. Ich-Narrative Ciceros in den Briefen aus dem Exil und danach, 91-113), die sich vorwiegend den Briefen aus der Zeit des Exils (58-57 v. Chr) widmet. Ein weiterer Beitrag befasst sich mit den Gärten in den Briefen Ciceros und gelangt zu einer veränderten Sicht auf bisher vermeintlich feststehende Erkenntnisse (Ilse Hilbold, Les horti de Rome, «une maison comme les autres»? Pratiques résidentielles aristocratiques dans la correspondance de Cicéron, 115-129). Die zeitliche Dimension im Rahmen des Chronotopos stellt Michel Humm in den Fokus seiner Überlegungen, wenn er das Verhältnis von Sozialbeziehungen und Allusionen auf die römische Geschichte in den Briefen herausarbeitet (Évocations historiques, représentations du passé et autoreprésentation dans la correspondance de Cicéron, 131-158).
Im zweiten Kapitel thematisiert Jan B. Meister das Verhältnis zwischen dem homo novus Cicero und der römischen Aristokratie (161-178). Franziska Reich setzt sich mit dem Faktum auseinander, dass ein Distinktionsmerkmal darin bestand, sich nicht nur literarisch zu betätigen, sondern einen intensiven Austausch von Texten zu pflegen und sich gegenseitig Werke zu widmen (Quod rogas ut mea tibi scripta mittam quae post discessum tuum scripserim : envois littéraires et pratiques de communication dans la correspondance de Cicéron, 179-201). Über Rechtsfragen im Zusammenhang mit familiären Angelegenheiten reflektiert Ann-Cathrin Harder („Wenn wir noch eine res publica hätten…“ – Familie, domus und die Grenzen des pater familias in Ciceros Briefen, 203-221). Im vierten Beitrag stehen Diffamierungen im Vordergrund (Anabelle Thurn, Improbare animum adversari. Invektivisches in Ciceros Reden und Briefen, 223-250).
Das dritte Kapitel umfasst Beiträge, in denen Themen angesprochen werden, die bisher in der Forschung nicht im Zentrum standen, sondern eher marginal behandelt wurden, wenn überhaupt. Im ersten Aufsatz werden medizingeschichtliche Aspekte angesprochen und Fragen der gesellschaftlichen Konsequenzen von Krankheiten thematisiert (Manuela Spurny, Omnia a te data mihi putabo, si te valentem videro – Tiros Beziehung zu Cicero während seiner Krankheitsphasen aus sozial- und medizingeschichtlicher Sicht, 253-280). Die Autorin, Ärztin und Klassische Philologin, hat vor allem die Briefe des sechzehnten Buches der Epistulae ad familiares erforscht, die bis auf eine Ausnahme an Tiro adressiert sind, den Cicero bekanntlich im Jahr 53 v. Chr. aus dem Sklavenstand befreite. Hauptsächlich geht es in vielen behandelten Briefen um den Krankheitszustand Tiros sowie um tagespolitische Fragen. Aus den Angaben dieser Briefe haben Forscher geschlossen, dass Tiro an Malaria gelitten hat. Natürlich ist es schwierig, 2000 Jahre später eine genaue Diagnose abzugeben. Im Falle der Pest, wie sie bei Thukydides beschrieben ist, konnte Karl-Heinz Leven (L.), Medizinhistoriker und Arzt, die Grenzen der Möglichkeiten klar darlegen, noch in der heutigen Zeit klare Diagnosen anhand der Angaben des griechischen Historikers vorzunehmen (K.-H. Leven, Thukydides und die „Pest“ in Athen, in: Medizinhistorisches Journal 26,1991,128-160). Orientiert an den Ausführungen dieses Aufsatzes von L. untersucht M. Spurny (S.) das Briefkorpus Ciceros, um eine sogenannte Verdachtsdiagnose zu präsentieren, die nicht mit einer endgültigen Diagnose verwechselt werden darf. Ich möchte die Ausführungen, die ich für überzeugend halte, nicht bewerten, da ich kein Mediziner bin. Vielmehr ist folgendes zu bedenken: Im weiteren Verlauf ihrer Darlegungen analysiert S. „die Briefe an Tiro im Spiegel antiker Brieftheorie“ (264-269) und klärt „Tiros Verhältnis zu Cicero während seiner Krankheitsphasen“ (269-276). Dabei vermag S. herauszuarbeiten, dass der berühmteste Redner Roms mehrfache Ziele mit seinen Briefen an Tiro verband. Sie waren nicht nur an seinen libertus gerichtet, sondern offensichtlich von vornherein für eine Veröffentlichung vorgesehen. Cicero präsentiert sich einerseits als treusorgender pater familias und stellte sich damit in die Tradition des älteren Cato (Plinius, nat. XXIX 15), andererseits gelang es ihm, sich als idealen Politiker zu zeigen. Auch die Gefühle, die Cicero in den Briefen für Tiro bekundet, sollte man nicht für bare Münze nehmen, was natürlich auch nicht bedeuten soll, „dass er Tiro gegenüber gleichgültig war oder ihn lediglich als wertvollen Helfer im Alltag betrachtete“ (277/278). S. hat auf wichtige Sekundärliteratur zurückgegriffen, sie hätte mit Gewinn auch das Lexikon von L. heranziehen können (K.-H. Leven, Antike Medizin. Ein Lexikon. München 2005). Im nächsten Beitrag geht Simone Berger Battegay (B.) einem Sujet nach, das in der bisherigen Forschung immer wieder untersucht wurde, nämlich Ciceros Meinung über die Griechen (Dies., Cicero, die Griechen und das Fremde in mikrogeschichtlicher Perspektive, 281-313). Der traditionellen Haltung, die darin bestand den Nachweis zu erbringen, dass Cicero entweder eine negative oder eine positive Position gegenüber den Griechen einnahm, setzt B. einen neuen Ansatz entgegen, nämlich den Briefen Ciceros mit Hilfe einer mikrohistorischen Lektüre näher auf den Grund zu gehen. Sie nimmt zunächst Stellung zu den Ergebnissen der älteren Forschung (282-286), um dann ihren Zugriff vorzustellen und den Leserinnen und Lesern zu erläutern. Ein Vorteil bei dieser Methode ist sicherlich, dass nicht wie bisher auf die Leistungen bedeutender Individuen geschaut wird, sondern dass Aspekte „der unbedeutenden Seite des Lebens“ beachtet werden (287). Diese Individuen waren ebenfalls an der Gestaltung der historischen Wirklichkeit beteiligt und verdienen Aufmerksamkeit. B. erklärt den methodischen Zugriff folgendermaßen: „Um diesen epistemologischen Anspruch zu erfüllen, verkleinern die Mikrohistorikerinnen und -historiker den historischen Ausschnitt geographisch, personenbezogen und/oder zeitlich. Sie betrachten das so abgesteckte Feld gleichsam durch eine Vergrößerungslinse und richten ihre Untersuchung auf die lebensweltliche Ebene des Wahrnehmungsradius der einzelnen historischen Subjekte“ (287). Die letzten beiden Aufsätze stellen einmal das Thema Trauer (Susanne Froehlich, Zerrissen Fäden? Der Austausch über Trauerfälle und die Komplexität des sozialen Netzwerks in Ciceros Briefen, 315-344), dann Geschlechterfragen (Th. Späth, Geschlecht und Epistolographie. Männlichkeit in Ciceros Briefen des Sommers 44, 345-402) in den Vordergrund.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Autorinnen und Autoren auf aktuelle theoretische und methodologische Ansätze der historischen Anthropologie zurückgreifen und dadurch die Möglichkeit schaffen, die römische Sozialgeschichte unter neuen Blickwinkeln weiterzuentwickeln. Hervorzuheben ist die intensive Kooperation unter den deutsch- und französischsprachigen Forschern der Universitäten im Raum Basel, Freiburg/Br., Mulhouse und Strasbourg. So gelingt es ein vielfältiges Bild des gesellschaftlichen Alltags im 1. Jahrhundert v. Chr. zu entwerfen.
Rezensent: Dietmar Schmitz

Oktober 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
John Scheid mit Milan Melocco / Nicolas Guillerat: Rom verstehen. Das Römische Reich in Infografiken. Aus dem Französischen von Martin Bayer. München: dtv 22022, 128 S., 26,-- €
Wer von uns, die wir uns in Schule, Universität oder sonstwo professionell mit der Antike befassen, hätte sich nicht schon einmal gewünscht, Rom wirklich zu verstehen. Eine neue Publikation aus dem Hause dtv, die entfernt an die früheren dtv- Atlanten (zur Philosophie, zur Geschichte etc.) erinnert, aber im Format auf ein mehrfaches Volumen gewachsen ist), verspricht ein solches Verstehen zu vermitteln.
Das Buch besteht aus drei Hauptkapiteln: „Gebiet und Bevölkerung des Römischen Reichs“ (9-33), „Verwaltung, Verehrung, Versorgung“ (35-73, gemeint ist eher „Kult“ oder „Religion“, aber dann wäre der Mittelteil des Trikolons gestört), „Die römische Militärmacht“ (72-125, was auch das Titelbild, dem ein römischer Militärhelm zugrunde liegt, prägt). Es ist klar, dass vormoderne Quellenarmut bzw. die selektive Wahrnehmung in diesen Quellen (etwa, dass bei den Einwohner- und Steuerzählungen Frauen, Kinder, Sklaven nicht erschienen) per se zu weniger zuverlässigen Zahlen führen, als wir Heutigen das aus den Medien gewohnt sind und auch als die Darbietung im Buch suggeriert (das ist gewissermaßen die warnenden Generalklausel), dennoch sind die hier vorgelegten Resultate unter diesen Prämissen eindrucksvoll und durchaus erhellend.
So erfährt man jeweils in Zahlen und veranschaulichenden Graphiken, dass das römische Territorium von 983 km2 am Ende des 6. Jahrhunderts auf 160 000 km2 im Jahr 90 v.Chr. anwuchs. Parallel dazu stieg die Gesamtbevölkerung der römisch beherrschten Gebiete von 3,5 Millionen 250 v.Chr. auf 46 Millionen 200 n.Chr. (12-13: die komplexe Graphik ist hier besonders erhellend), während Rom selbst im 3. Jahrhundert n.Chr. 1,75 Millionen Einwohner erreichte (wie die Zahlen erhoben werden, wird nicht erörtert, vgl. aber die knappe, doch erhellende und differenzierende Darstellung bei F. Kolb, Das antike Rom, München 22009, Register s.v. Einwohnerzahl). Eine ganze Seite (17) ist den unterschiedlichen Gebäudetypen in den römischen Stadtregionen gewidmet, was als bloßer Text sicher nicht so instruktiv ausgefallen wäre.
So könnte man nun die einzelnen Abschnitte durchgehen, aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Wer solche graphischen Darstellungen als hilfreich schätzt, findet hier reiches Material und wird gewiss an so mancher Stelle länger verweilen. So ist für mich die Graphik mit dem jeweils ersten Auftreten der Götter in Rom durchaus erhellend (54-55), während man die zeichnerische Darstellung der römischen Innenstadt und ihrer Monumente (18-19) so oder so ähnlich schon oft gesehen hat. Hilfreich sind auch die geographisch-quantifizierenden Angaben über die Verteilung und Entwicklung der Religionen im Imperium Romanum oder (etwas überraschend unmittelbar anschließend) der Wirtschaft und des Handels.
Wen die römischen Legionen faszinieren, der findet etwa Angaben über das jeweilige Aufstellungsjahr und die Zahl der Feldzüge und sogar über die Abzeichen, über die Schlachtordnungen und Kampftaktiken im Lauf der Jahrhunderte (z.B. zu Cannae und Zama), über die Wege und Aufenthaltsorte von Caesars Legionen in Gallien etc. etc. Oder mit einem Wort: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und wer das Buch richtig zu benutzen weiß und sich über die nicht immer stabile Faktengrundlage im Klaren ist, kann für die Lehre und die eigene Belehrung eine Reihe von nutzbringenden Informationen (mitsamt deren graphischer Aufarbeitung) gewinnen.
Das Buch kann seine französische Herkunft (zuerst: Paris 2020) nicht verleugnen: Halbwegs unproblematisch ist die relativ prominente Stellung Galliens (32-33: „Mosaik der Stämme“, womit die gallischen Stämme gemeint sind), denn auch hierzulande liest man ja Caesars Bellum Gallicum (vgl. 119-123) und kennt das römische Trauma der Besetzung des Kapitols durch die gallischen Senonen. Aber die Bibliographie, die ausschließlich aus französischen und englischsprachigen Titeln besteht hätte doch ein wenig redaktionelle Anstrengung verdient gehabt, um die Weiterarbeit zu erleichtern und auch die deutschsprachige Forschungsleistung zu würdigen und dem Zielpublikum entgegenzukommen (dass selbst Ronald Symes Roman Revolution in der französischen Übersetzung angeführt ist, lässt sich nur mit verlegerischer Bequemlichkeit rechtfertigen).

Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
September 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Simeonsstift Trier und dem Museum am Dom Trier (Hrsg.), Der Untergang des römischen Reiches. Katalog zur großen Landesausstellung in Trier vom 25.06 bis 27.11.2022. 465 S. WBG Theis: Darmstadt 2022. EUR 40,- (Buchhandelspreis)/WBG für Mitglieder: EUR 32,- (ISBN: 978-3-8062-4425-0 [Buchhandelsausgabe]; ISBN: 978-3-944371-16-0 [Museumsausgabe]; Kaufpreis in den Museen: EUR 29,90.).
Die drei Museen inTrier: das Rheinische Landesmuseum, das Stadtmuseum Simeonsstift und das Museum am Dom haben wieder einmal vorzüglich kooperiert und eine besondere Landesausstellung organisiert. Im Jahr 2007 haben sie eine Römerausstellung zu Kaiser Konstantin dem Großen angeboten, 2016 zu Kaiser Nero, und jetzt im Jahr 2022 zum „Untergang des Römischen Reiches“ (vom 25. Juni bis 27. November 2022). Der Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Heike Otto, sowie dem Direktor des Rheinischen Landesmuseum Trier, Marcus Reuter, ist beizupflichten, wenn sie mit voller Berechtigung im Grußwort feststellen, dass „kaum ein Ort in Mitteleuropa für ein solches Ausstellungsprojekt geeignetere Rahmenbedingungen bietet als Trier, das mit seinem reichen spätantiken Erbe noch heute beeindruckt.“ Ehrlicherweise müsste der Titel ergänzt werden und lauten: Der Untergang des Römischen Reiches im Westen, denn bekanntlich hat das oströmische Reich den Zusammenbruch des weströmischen Kaisertums überdauert und hörte erst 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II. auf zu existieren. Den Herausgebern des Katalogs ist es gelungen, namhafte Forscherinnen und Forscher für die Abfassung von Beiträgen zu gewinnen. Über das Thema: Der Untergang des Römischen Reiches gibt es seit vielen Jahren intensive Diskussionen, die bis heute anhalten. Einen entscheidenden Anstoß für die Debatte, wann das römische Reich verfallen und untergegangen ist, bot Edward Gibbon mit seinem Werk The HistoryoftheDecline and Fall ofthe Roman Empire, London 1766-1788. Wer sich für diese Thematik interessiert, wird in verschiedenen Aufsätzen umfassend informiert. Bevor ich auf einzelne Beiträge näher eingehe, mögen einige Informationen zum Aufbau des Katalogs gestattet sein. Er besteht aus drei Teilen, die sich gegenseitig ergänzen. Der erste Teil bezieht sich auf Objekte, die im Rheinischen Landesmuseum Trier ausgestellt sind, der zweite auf solche, die die Besucherinnen und Besucher im StadtmuseumSimeonsstiftvorfinden, der dritte auf Gegenstände, die im Museum am Dom eingehend besichtigt werden können.
Bereits im Prolog bietet Marcus Reuter Grundsätzliches zum Thema ‚Untergang‘(14-19). Alle weiteren Beiträge sind ähnlich aufgebaut wie dieser. Die meist kurzen Textpassagen werden durch Bildmaterialien unterstützt. Knappe Angaben zum Gegenstand selbst werden angeboten, und wenn er Aufnahme in der Ausstellung fand, wird über die Katalognummer informiert. Des Weiteren gibt es am Ende des Aufsatzes jeweils einen Abbildungsnachweis und Anmerkungen. Aus Platzgründen wird nur der Name des Autors und das Publikationsjahr angeführt, wer nähere Informationen zum genauen Titel und Erscheinungsort erhalten möchte, schaut im sehr umfangreichen Anhang in der Rubrik: Literatur nach (420-450). Im Artikel von M. Reuter – wie auch in weiteren Beiträgen – werden Faktoren genannt, die den Untergang begünstigten; vermieden werden dabei verständlicherweise Hinweise auf eine Monokausalität. M. Reuter zählt einige Gründe für den Untergang auf, die jeweils einen gewissen Anteil an der historischen Entwicklung hatten. Durch das Mehrkaisertum waren Bürgerkriege entstanden, aufgrund der katastrophalen innenpolitischen Lage brachen die Steuereinnahmen weg (17), es lassen sich Plünderungszüge auswärtiger Gruppen beobachten; die angebliche Dekadenz des Zeitalters, die Völkerwanderung, Transformationsvorgänge, Krankheiten wie die Pest und die Bleivergiftung wurden als Faktoren genannt. M. Reuter hat wahrscheinlich Recht mit seiner Vermutung, dass „es ungewiss bleibt, ob das Rätsel um den Fall Roms jemals endgültig gelöst werden kann“ (17). Es geht aber nicht nur um wichtige historische Prozesse und Ereignisse, sondern die Ausstellung zeigt an ausgewählten Beispielen, „welche kulturellen Auswirkungen das politische und militärische Ende Westroms für das Alltagsleben der damaligen Menschen hatte“ (17).
Im zweiten Abschnitt bietet Stefan Rebenich einen Überblick über die Theorien zum Untergang des Römischen Reiches seit 1500 Jahren (22-27). Sehr umfangreich ist der der dritte Abschnitt: Historischer Überblick (3-129). Um die Entwicklung im fünftenund sechsten Jahrhundert einordnen zu können, ist es ratsam, die Geschehnisse des dritten und vierten Jahrhunderts jeweils zu beleuchten. Das leisten mehrere Autoren; der Kölner Althistoriker Werner Eck wendet sich zum Beispiel der politisch-militärischen Neustrukturierung unter den Kaisern Diokletian und Konstantin (284-337) zu (36-41). Lothar Schwinden stellt die Usurpationen im vierten und fünften Jahrhundert in den Fokus seiner Betrachtungen (42-63). Hilfreich sind dabei einerseits eine tabellarische Übersicht über die Usurpatoren (47), andererseits aufschlussreiche Karten zu den kriegerischen Auseinandersetzungen in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, zu denen in der Zeit der Kaiser Honorius und Arcadius sowie zu den Auseinandersetzungen in der Epoche von Valentinian III. bis zum Ende des Weströmischen Reiches [424-476 n. Chr.] (56-63).Bruno Bleckmann prüft subtil, ob im Jahre 395 n. Chr. wirklich eine endgültige Teilung des Reiches vollzogen wurde – wie es in der Forschung oft dargestellt wird; er vertritt die Auffassung, dass das genannte Jahr in der Tat ein besonders wichtiges Datum im Zusammenhang mit dem Zerfall der Reichseinheit ist, aber: „Das Datum muss in eine Serie anderer wichtiger Zäsuren und Entscheidungen eingeordnet werden, deren Zusammenschau einen sich über mehrere Jahrhunderte erstreckenden Prozess beschreibt. Reichsteilungen, darunter auch solche, die zu einem Ost-West-Gegensatz führten, gab es schon vor 395, Gemeinsamkeiten blieben nach 395 bestehen“ (87). Timo Stickler analysiert den Putsch des Odoakerund stellt die Frage, ob 476 n. Chr. wirklich das Ende des Imperiums anzusetzen ist (118-123). Er gibt zu bedenken, dass eine letzte Stabilisierung des spätantiken Italienunter Theoderich dem Großen (489-526 n.Chr.) zu beobachten ist (119-121). T. Stickler sieht das traditionell angegebene Datum 476 n.Chr. als problematisch an, „denn der letzte, von Konstantinopel legitimierte Kaiser Iulius Nepos starb ja erst fast vier Jahre später, und die Reihe der oströmischen, später byzantinischen Kaiser setzte sich bis zur Schwelle der Neuzeit, 1453, fort“ (121). Für Andreas Goltz endete das weströmische Reich im sechsten Jahrhundert (124-129).Er konstatiert: „Der Niedergang oder, wie es in Teilen der modernen Forschung wohlwollender heißt, die Transformation des Weströmischen Reiches war ein langfristiger, komplexer, regional und zeitlich divergierender, von Veränderungen wie Kontinuitäten geprägter Prozess“ (125). A. Goltz sieht im Einfall der Langobarden in Italien 568 einen entscheidenden Einschnitt, wodurch die Apenninenhalbinsel eine „territoriale, politische und kulturelle Zersplitterung“ erfuhr (129). Er vertritt die Auffassung, das Ende des sechsten Jahrhunderts in Italien „das ‚Epochenpendel’ endgültig in Richtung Frühmittelalter ausgeschlagen hatte“ (129).
Der Titel des vierten Kapitels lautet: Brüche – Transformationen – Kontinuitäten (132-241). Hier sind einige Beiträge versammelt, die ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten. Fleur Kemmers etwa widmet sich dem Wert der Münzen. Man erfährt als Leser Details über die Prägestätten (moneta), über das Ende der Kleingeldproduktion und welche Konsequenzen sich aus den großen Änderungen in der Münzproduktion für den Umgang mit Münzen und Geld im Alltag ergaben (138-143). Im nächsten Beitrag stellt Christian Witschel seine Forschungsergebnisse zur spätantiken Stadtentwicklung im Westen des römischen Reiches vor (144-149). Erkann belegen, dass viele Städte in der in Frage stehenden Epoche noch lebensfähige politische, wirtschaftliche und religiöse Zentren waren (149). Weitere Themen dieses Kapitels sind die römischen Straßen, die Gladiatorenkämpfe, ländliche Siedlungsstrukturen, der Handel, die Keramikproduktion, die Sprache und die Sprachen, die Stellung des römischen Rechts, Kirchenschätze und Großbauten in Trier im fünften Jahrhundert sowie die Kleidung.
Im fünften Abschnitt werden nochmals Faktoren, die zum Untergang beitrugen (244-269) ausgewählt. Vor allem der Beitrag von Mischa Meier ist aufschlussreich: Der Untergang des Römischen Reiches und die Völkerwanderung (254-261). Er ist besonders prädestiniert, diesen Zusammenhang zu erhellen. Von ihm stammt das schon zu einem Standardwerk avancierte Buch: Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. (München 2019). M. Meier bezweifelt, dass klar ist, was unter den Begriffen ‚Völkerwanderung‘ und ‚Barbaren‘ genau zu verstehen ist. Daher präsentiert er seine Vorstellungen der beiden Begriffe. Darüber hinaus sieht er vielfältige Ursachen für den Untergang Westroms (258-261).
Der sechste Abschnitt geht der Frage nach: Warum ging das römische Reich unter? (272-289). Dabei kommen bedeutende Historiker wie Walter Pohl, Roland Steinacher und Peter Heather zu Wort.
Im siebten Abschnitt: Katalog (292-319) sind zahlreiche Objekte abgebildet; die Fotos sind von sehr hoher Qualität, so dass sogar Details von Münzen gut erkennbar sind.
Das achte Kapitel vereinigt Beiträge, die das Christentum und den Rhein-Mosel-Raum, vor allem die Stadt Trier, in das Zentrum stellen. Orte des Glaubens wie die verschiedenen Kirchen in Trier werden ebenso thematisiert wie das Wirken der frühen Bischöfe in Trier, aber auch die Rolle und die Bedeutung alter Kulte. Die hier besprochenen Objekte finden die Besucherinnen und Besucher im Museum am Dom Trier.
Im neunten Kapitel werden Themenbereiche vorgestellt, die im Stadtmuseum Simeonsstift eine bedeutende Rolle spielen: Das Erbe Roms. Visionen und Mythen in der Kunst (360-409). Dabei wird der Blick auf die Herrscher im Mittelalter gelenkt, auf die Ruinen, die die Antike „überlebt“ haben; weitere Aspekte sind Der Untergang Roms in der Literatur (398-403) sowie Rom und der Untergang des Römischen Reiches als Filmtopos (404-409).
Insgesamt liegt ein sehr gut konzipierter Band vor, der viele Informationen zum Thema liefert. Die zahlreichen Beiträge bieten ein großes Spektrum an Aspekten, die beim Untergang des römischen Reiches eine Rolle spielten. Mit Hilfe dieser Beiträge lassen sich die Ausstellungsobjekte besser einordnen. Der Band ist mit großer Akribie lektoriert, die Bildmaterialien ausgezeichnet präsentiert. Denjenigen, die die Ausstellung in Trier besuchen wollen, sei empfohlen, den Band vorher durchzuarbeiten, um so die Möglichkeit zu haben, sich auf bestimmte Objekte zu konzentrieren. Die Lektüre des Buches ist für jeden eine Bereicherung, der sich für Fragen des Untergangs des römischen Reiches interessiert.
Rezensent: Dietmar Schmitz
August 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Günther E. Thüry: Römer, Mythen, Vorurteile. Das alte Rom und die Macht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2022, 112 S. mit 58 farb. und 13 s/w Abb, 32,-- € (Mitglieder: 25,60 €)
Mit einem klassischen Trikolon (seit C.W. Ceram, Götter, Gräber und Gelehrte von 1949) betitelt Günther E. Thüry sein neuestes (wenn ich richtig gezählt habe: zwölftes) Buch, das auf überschaubarem Raum und umfangreich bebildert sich vor allem der Frage nach dem kriegerischen und – wie man neuerdings sagt – toxisch-männlichen Rom zuwendet.
Man könnte Günther Thüry vielleicht als einen „Von-der-Seite-Denker“ charakterisieren (leider ist die Zusammensetzung mit „Quer-“ ja durch unappetitliche Aktivitäten sozusagen verbrannt, sonst würde ich diese Bezeichnung wählen). Seine Untersuchungen zum römischen Müll und Abfall, die Rehabilitierung des garum oder jüngst im Gymnasium (129, 2022, 143-163) zum erotischen Wortschatz auf römischen Fibeln nähern sich den antiken Gegenständen auf ungewohnten Wegen, Seitenpfaden gewissermaßen, finden überraschende Perspektiven und sind dann auch für die zunächst vielleicht verwunderten Leser:innen überaus erhellend (beispielsweise versteht man die Literatursprache der römischen Liebeselegie besser, wenn man sie mit den Alltagstexten auf den Fibeln zusammenbringt).
In Römer, Mythen, Vorurteile möchte Thüry die (klassischen) Römer und das Imperium Romanum von einigen weniger in den Altertumswissenschaften (auch wenn einige Altertumswissenschaftler genannt werden) als eher in einer breiteren Öffentlichkeit anzutreffenden Fehlwahrnehmungen befreien. Ausführlich befasst sich so der erste Teil („Herrschsucht ohne Ende?“, 11-30) mit der kriegerischen Expansion des römischen Territoriums, die er als weitgehend von defensiven Motiven getragen einstuft (Ausnahmen wie die gleichzeitigen Zerstörungen Karthagos und Korinths werden aber nicht verschwiegen) und sich dabei auf die römische Auffassung vom bellum iustum (und die einschlägige Dissertation von Sigrid Albert von 1978, gedr. 1980) stützt. Die sich über drei Seiten erstreckende Tabelle (von der Gründung Roms bis zu Octavians Sieg über Antonius und Kleopatra) mit Ereignisse und jeweiligen Kriegsgründen lässt Thürys Auffassung sehr deutlich werden, allerdings ist zu bedenken, dass wir nur die Sicht der Sieger haben, dass eine punische oder gallische Geschichtsschreibung beispielsweise fehlt. Im Grunde genommen buchstabiert Thüry aus, was Cicero in De re publica dem Laelius über den Zusammenhang von gerechtem Krieg und Ausweitung der römischen Herrschaft in den Mund legt. So wird auch exemplarisch deutlich, dass Thüry kein romkritisches, sondern ein affirmatives Buch geschrieben hat und auch schreiben wollte.
Organisch schließt sich das Kapitel Herrschaft durch Unterdrückung? (31-54) an, wo er herausarbeitet, dass das Imperium Romanum kein Vorläufer neuzeitlicher Kolonialreiche war, sondern durch seine Integrationskraft gerade ab dem Beginn der Kaiserzeit für die zuvor unterworfenen Völker so attraktiv wurde, dass sie sich an die römische Zivilisation und Kultur anschlossen und sich eher romanisierten denn romanisiert wurden. Dabei gingen aber auch die eigenen lokalen Traditionen (etwa in der Religion) nicht verloren, sondern lassen sich in zahlreichen archäologischen Zeugnissen noch wiederfinden. Auch wenn sich Thüry in der Einleitung gegen manche aktuellen Trends der historischen Wissenschaften verwahrt (10), lässt sich komplementär auf die amerikanische, ihrer südasiatischen Wurzeln bewusste Altertumswissenschaftlerin Nandini Pandey (Johns Hopkins University) und ihr Projekt zu „Roman Diversity“ (https://tinyurl.com/2s3r28wy) anführen, das mit dem Instrumentarium der Postcolonial Studies die multiethnische Struktur des Römischen Reiches untersucht – es lohnt sich also genau hinzusehen, ob man nicht unerwartete Verbündete gewinnen kann und die modernen Theorien nicht doch hilfreich sind.
Die beiden letzten Kapitel (Der Krieg in den Genen?, 55-65; Weinen echte Römer nicht?, 66-95) stellen die vor allem in Filmen, Romanen und auch Reenactment-Events verbreitete Auffassung in Frage, dass die Römer von Natur aus nur auf Krieg gesinnt seien und geradezu einen ubiquitären Männlichkeitskult gepflegt hätten. Auch das kann Thüry sehr plausibel differenzieren und etwa auf die deutlich geringere Zahl von unter Waffen stehenden Soldaten als in modernen Staaten verweisen oder auf seit dem Principat entstehenden Friedenstexte (wie Tibull 1,10) und Friedensmonumente wie die Ara Pacis Augustae verweisen. Zur ganzen Wahrheit aber gehört hier auch, dass Ovids Beschreibung der Ara Pacis am Ende des ersten Fasti-Buches gerade den Zusammenhang von freiwilliger oder erzwungener Unterwerfung fremder Völker und römischem Frieden herausstellt und damit gewiss eine in Rom verbreitete Auffassung trifft.
Auch dass nicht alle Römer stets martialisch und gewalttätig waren, können die lateinischen elegischen Dichtungen ebenso ad oculos demonstrieren wie die pädagogischen Ratschläge eines Seneca oder Quintilian, allerdings steht bei Letzteren zu befürchten, dass im schulischen Alltag doch eher der plagosus Orbilius denn die quintilianische Reformpädagogik anzutreffen war. Auch hier noch ein ergänzender Hinweis darauf, dass aktuelle kulturwissenschaftliche Theorien nicht einfach abgelehnt werden sollten, sondern komplementär beigezogen werden können: Die Gender Studies haben ja auch das Männlichkeitsbild ins Auge gefasst, im Jahrgang 2021 des Gymnasium waren zwei Hefte (verantwortet von Petra Schierl, Basel/München) den antiken Männerbildern gewidmet – und das mit sowohl plausiblen als auch eindrucksvollen Ergebnissen. Wenn man also gegen Pauschalisierungen anschreibt, und das mit Recht, dann sollte man auch selbst Pauschalisierungen vermeiden.
Alles in allem ist Günther Thüry ein Buch gelungen, das so manche außerhalb der Klassischen Altertumswissenschaft und der Altphilologie verbreitete Vorurteile erschüttert – und es ist zu hoffen, dass es in diesen Kreisen auch gelesen wird (die Buchshops in Museen und Ausstellungen könnten hierfür eine gute Plattform sein). Darüber hinaus lässt es sich durch die Kürze und Klarheit der Argumentation auch sinnvoll im schulischen und sogar universitären Unterricht einsetzen. Dass das Buch auch Widerspruch provoziert, ist klar und ein gutes Zeichen, denn nur so kann die Diskussion weitergehen und die Antike lebendig gehalten werden.
Und schließlich: Thürys Buch lässt sich auch gut als Kontrast zum sehr skeptisch-kritischen Buch von Armin Eich, Die Verurteilung des Krieges in der antiken Literatur lesen, das jüngst in dieser Rubrik vorgestellt wurde. Man kann sehr instruktiv sehen, welche unterschiedlichen Folgerungen man aus den antiken Texten und Bildern ziehen kann – und wie man immer wieder das eigene Urteil auf den Prüfstand stellen muss.
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
Juli 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Zenk, J. (2021), Die Anfänge Roms erzählen. Zur literarischen Technik in der ersten Pentade von Livius‘ ‚Ab urbe condita‘. Göttinger Forum für Altertumswissenschaft – Beihefte Neue Folge, Bd. 12. De Gruyter: Göttingen. 356 S. EUR 109,95 (ISBN 978-3-11-075803-0).
Johannes Zenk befasst sich mit dem Geschichtswerk des Livius, dem M. von Albrecht in seiner Literaturgeschichte „allgemeine Beliebtheit“ in der Rezeption attestiert. Zahlreiche Historiker, Rhetoriker und Autoren anderer Gattungen verschiedener Epochen loben Aspekte seines Oeuvres (M. von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius und ihr Fortwirken. Bd. 1. Bern 1992, 682 (jetzt auch in der 3., verbesserten und erweiterten Auflage, Berlin/Boston 2012)). Bei der Studie, die Zenk vorlegt, handelt sich um eine Dissertation, die unter der Ägide von Markus Schauer (Universität Bamberg) entstanden ist. Im Vorwort spricht der Verfasser von seiner Begeisterung für Livius, die schon während seines Studiums geweckt worden sei. Dieser Enthusiasmus durchzieht in positiver Art und Weise die gesamte Publikation.
Das Buch besteht aus drei Kapiteln; in der Einleitung und Zielsetzung (Kap. 1) beschreibt Zenk klar umrissen die Fragestellung, legt einen Forschungsbericht vor und erläutert sein methodisches Vorgehen (1-35). Das zweite Kapitel ist das bei weitem umfangreichste und trägt den Titel: Die Romdarstellung aus primär textimmanenter Perspektive (36-328). Im dritten Kapitel fasst Zenk seine Überlegungen zusammen: Fazit (329-336). Daran schließen sich das Abkürzungsverzeichnis (337), das Literaturverzeichnis (338-351, dazu später mehr), der Sachindex (Stellen in Auswahl, 351-352) sowie der Stellenindex an (353-356).
Zu Beginn der Einleitung skizziert Zenk den historischen Hintergrund der Entstehungszeit von ab urbe condita. Kurz nach der Schlacht von Actium (31 v.Chr.) hat der römische Geschichtsschreiber Titus Livius begonnen, sein umfangreiches Werk zu verfassen. Es umfasst 142 Bücher, die leider nicht alle überliefert sind und bis zum Jahr 12 bzw. 17 n.Chr. reichen, je nachdem wann man den Tod des Historikers ansetzt. Zenk geht in gebotener Kürze auf die wichtigsten Entscheidungen von Octavian/Augustus und auf Ehrungen ein, wie zum Beispiel den Tugendschild, der ihm aufgrund verschiedener Tugenden verliehen wurde: virtus, clementia, iustitia, pietas. Aus Sicht des Livius entstanden diese Tugenden in den ersten Jahren der römischen Geschichte, deren Genese der Historiker mittels Aitien und Exempla genau erläutert. Auf diese Aspekte geht Zenk im Verlauf seiner Arbeit immer wieder ein. Er legt sich bei der Frage der exakten Entstehungszeit der ersten Pentade nicht genau fest, naheliegend für ihn ist aber als spätestes Datum 25 v. Chr, d. h. konkret, dass die Entstehungszeit „nicht mit der späteren augusteischen Friedenszeit gleichgesetzt werden“ (3) sollte, sondern in einer Phase anzusetzen ist, die zwar nach dem Ende der Bürgerkriege zu datieren ist, aber noch geprägt war von einer gewissen Unsicherheit, ob Frieden Bestand haben würde. Zenk geht auf zahlreiche Fragen der Forschung ein, die hier natürlich nicht alle genannt werden können. Ob Livius Anhänger des Augustus oder Republikaner war, möchte Zenk nicht entscheiden. Er verweist mit voller Berechtigung darauf, dass „die zeitgeschichtlichen Bücher des Livius“ nicht erhalten sind (3). Zenk erinnert auch daran, dass R. von Haehling in seinem Werk nach genauer Prüfung betont, dass unser Historiker den Princeps Augustus nicht vorbehaltlos überhöht (3).
Zenk geht auch auf die Frage ein, auf welche Quellen sich Livius gestützt hat. Nachweislich waren die Publikationen der jüngeren Annalistik die entscheidenden Quellen für sein Geschichtswerk (7). Livius schreibt über die Frühgeschichte, und zwar aus gesamtrömischer Sichtweise. Dies ist etwas Besonderes (7): „Livius stellt sich damit in die Tradition der Autoren, die Gesamtgeschichten verfassen, obwohl diese zum Ende des ersten Jahrhunderts zugunsten von zeitgenössischen Werken wie beispielsweise den Historien von Sallust und historischen Monographien (…) aufgegeben wurde.“ (7)
Zenk thematisiert auch die von der Forschung oft aufgeworfene Frage nach der Einteilung des Gesamtwerks. Manche sprechen von Pentaden, andere von Dekaden, wieder andere sogar von Pentekaidekaden (11). Unstrittig ist der Einschnitt nach dem Buch 5 (wegen des Binnenproöms); in den Büchern 6 bis 15 steht die Eroberung Italiens im Vordergrund, d.h. die zweite und dritte Pentade gehören inhaltlich eng zusammen. Nach eingehender Analyse glaubt Zenk beweisen zu können, dass die praefatio und die erste Pentade als Einheit zu betrachten sind und schlägt eine Veröffentlichung zwischen 27 und 25 v. Chr. vor (13).
Auf einigen Seiten erläutert Zenk die Fragestellungen, die sich für ihn ergeben haben (13-21). Zunächst konstatiert er ein Desiderat in der Liviusforschung, nämlich das Fehlen einer „weitestgehend textimmanenten Untersuchung zur Romdarstellung des Livius hinsichtlich der römischen Frühzeit, über die Livius in der ersten Pentade berichtet“ (13). Welche Aspekte Livius in seinem Opus über Rom behandelt, geht aus der praefatio hervor, die Zenk zum Teil auf S. 15 hat abdrucken lassen. Eine Übersetzung wird nicht präsentiert, aber der Autor paraphrasiert wichtige Aussagen und analysiert sie unter der gewählten Fragestellung. Er nimmt die Leser/Leserinnen gewissermaßen an die Hand und führt sie sukzessive durch den Text. Ihm ist auch bewusst, dass sich in Rom die Erinnerungskultur und damit verbunden die Geschichtsschreibung in der ausgehenden Republik und der beginnenden Kaiserzeit entscheidend verändert haben (16). Zenk vergisst auch nicht den Aspekt hervorzuheben, dass Livius aus Padua stammt und damit gewissermaßen „eine Art Außenperspektive auf Rom hatte“ (16). Er stellt die von Livius gewählten Kategorien vor, die er in der praefatio erkennt. Nach Zenk beleuchtet der römische Historiker „die Bedeutung übernatürlicher Phänomene“ (16). Livius sei davon überzeugt, dass es in der Frühzeit eine Mischung von Menschlichem und Göttlichem gegeben habe (Praefatio 7: datur haec venia antiquitati ut miscendo humana divinis primordia urbium augustiora faciat). Damit hat sich Livius nach Zenk vom Göttlichen distanziert und legt nun „genauere, rationale Kategorien vor, die sein Werk über die Geschichte Roms leiten sollen“ (16/17). Die von Zenk gewählte Interpretationsmethode (textimmanente Analyse) erlaubt ihm, die Originaltexte genau zu untersuchen und schrittweise in der Erklärung voranzuschreiten. Dieses Verfahren ist transparent und kann auch in der Schule angewandt werden, ohne dass zuvor theoretische Konstrukte vorgestellt werden müssen, die zumindest für Schülerinnen und Schüler meist schwer nachvollziehbar sind. Das bedeutet nicht, dass auch andere Interpretationsverfahren als obsolet deklariert werden sollten, aber der Autor hat sich nun einmal für das textimmanente Verfahren entschieden. Zenk präsentiert auf S.18 die von Livius gewählten Kategorien: zunächst geht es um „die Bedeutung der Götter bzw. der übernatürlichen Phänomene“ (18); die Götter spielen zwar eine große Rolle für die Frühzeit, aber Livius distanziert sich von ihnen. In diesem Zusammenhang untersucht Zenk genau die Konzeption von fatum und die Zeichen wie Prodigien und Augurien. Danach wendet er sich den „vermeintlich historisch belegbaren Aspekten der Romdarstellung“ zu. Unter der Junktur „imperium et partum et auctum“ stehen „das Herrschaftsgebiet“, „die Entwicklung der Bevölkerungszahl und das Wachstum der römischen Herrschaft“ und „die Bedeutung von Krieg und Frieden im Äußeren und im Ineren (domi militiaeque)“ im Fokus (18). Für Zenk ist entscheidend, wie Livius diese Kategorien anwendet und mit „seiner literarischen, insbesondere narrativen Technik darstellt“ (19). Der zeitliche Rahmen der Analyse erstreckt sich von der Vorgeschichte der Stadtgründung bis zur Königszeit und der Epoche des Galliereinfalls (387 v. Chr.)
Der Forschungsbericht (21-24) stellt die Publikationen heraus, auf die sich Zenk besonders stützt. Dazu gehören mit voller Berechtigung die im Jahr 1964 nachgedruckte Monographie von E. Burck: Die Erzählkunst des T. Livius (Berlin/Zürich), die erstmals 1933 erschienen war, die verschiedenen Beiträge, die D. Pausch zur Erforschung des livianischen Werks geleistet hat (vgl. Literaturverzeichnis, S. 347), das Standardwerk von T. J. Luce, Livy. The Composition of His History, Princeton 1977, D. S. Levene, Religion in Livy, Leiden/New York/Köln 1993, G. B. Miles Livy. Reconstructing Early Rome, Ithaca /London 1995 sowie A. Feldherr, Spectacle and Society in Livy’s History, Berkeley/Los Angeles/London 1998. Einen Platz im Forschungsbericht hätte auch die Studie von R. von Haehling verdient, auf die sich Zenk immer wieder bezieht: Zeitbezüge des T. Livius in der ersten Dekade seines Geschichtswerkes: nec vitia nostra nec remedia pati possumus, Stuttgart 1989.
Sein methodisches Vorgehen erläutert Zenk sehr ausführlich (24-35). Er stützt sich dabei auf die Instrumente der Erzähltheorie bzw. der Narratologie. Schwerpunktmäßig untersucht er die Erzählperspektive und die Variation des Erzähltempos (24). Zenk setzt voraus, dass „das Geschichtswerk des Livius eine Erzählung ist“ (24). Hierbei ist ihm aber bewusst, „dass die relevanten Literaturtheorien aus dem Bereich der Narratologie für rein fiktionale, moderne Texte und nicht anhand von und für antike Texte entwickelt worden sind und auf die Gattung ‚Geschichtsschreibung‘ mit besonderer Vorsicht anzuwenden sind“ (25). Entsprechend den Vorgaben der Erzähltheorie gilt es, das Verhältnis von Autor und Erzähler zu bestimmen (27). Es gäbe - so Zenk – zwei Stimmen, die unterschieden werden müssen: „die des Erzählers, der die Ereignisse, d. h. die Handlung, erzählt, und die des Autors, der in der ersten Person Singular in der praefatio, im Binnenproöm des sechsten Buches und an anderen Stellen auftritt“ (29). Weiterhin sei klar, dass Livius eine auktoriale Perspektive einnehme: „Er weiß mehr als alle Figuren in der Handlung und kann auch die Reden und Gedanken der historischen Personen erzählen“ (29). Aufgrund des gewählten Interpretationsverfahrens kann Zenk konstatieren, dass der Historiker dem Leser eine Multiperspektivität anzubieten vermag. So können verschiedene Gruppen zu Wort kommen, zum Beispiel „die Römer“ oder „die Volkstribunen“ (30). Dialoge wie in den Werken des Sallust, der Cato und Caesar gegeneinander sprechen lässt, gibt es im livianischen Geschichtswerk nicht. Zenk arbeitet an verschiedenen Textstellen heraus, dass sowohl die praefatio als auch die erste Pentade im Wesentlichen einen fiktionalen Text darstellen (32). Bei der Analyse der Textabschnitte orientiert sich Zenk am sogenannten close reading, d. h. er untersucht den jeweiligen Text sehr genau, spürt Bedeutungsnuancen und sprachliche Charakteristika auf, achtet exakt auf einzelne Lexeme, auf die Syntax und auch auf die Reihenfolge der Sätze. Es liegt am Geschick des Interpreten, die zahlreichen Einzelbeobachtungen so in seine Interpretation einzuflechten, dass der Text lesbar und für den Leser nachvollziehbar bleibt. Dies ist Zenk nach Ansicht des Rezensenten sehr gut gelungen. Im Folgenden möchte ich dafür drei ausgewählte Beispiele liefern.
Erstes Beispiel: Die Apotheose des Romulus. Zenk untersucht gemäß seinen Vorstellungen die Textstelle des Livius zur Apotheose des Romulus (1,16,1-8) praktisch Satz für Satz, arbeitet für die moralischen Werte wie virtus und fides die kontextgerechte Bedeutung heraus und geht auf sprachliche Eigenheiten ein. So gelingt ihm der Nachweis, dass sich Livius phasenweise einer epischen Diktion bedient (zum Beispiel das Wort pubes), und gibt Beispiele für die Multiperspektivität. Allerdings verzichtet er auf eine Anspielung auf die Apotheose des Aeneas, die von verschiedenen lateinischen Autoren behandelt worden ist, etwa von Vergil in der Aeneis (Aen.12, 791-806) und von Ovid in den Metamorphosen (Met.14, 581-608). Auch die Rede des Proculus Iulius, die dieser vor der Volksversammlung hält (1,16,57), enthält episch-hymnische Elemente. Zenk legt dar, wie Livius Erzählebenen wechselt (direkte Rede, auktorialer Kommentar). Die vorgelegte Analyse der Apotheose des Romulus ergibt erstens, dass Livius sie als Element der Sagen der Frühzeit erzählt, sich aber mit Bezugnahme auf die römischen Werte von ihr distanzieren kann. Gewissermaßen beiläufig schafft es der Historiker, das Aition für die Verehrung des Gottes Quirinus zu thematisieren und dem „impliziten Rezipienten wie auch dem Leser den Willen der fata zu offenbaren“ (117).
Zweites Beispiel: Aeneas. In welchem Verhältnis Aeneas und Romulus stehen, überliefern die römischen Autoren uneinheitlich. Zu beachten bleibt indes, dass zwischen beiden ein Zeitraum von annähernd 300 Jahren liegt, so dass sich die Version, Romulus sei ein Enkel oder gar Sohn des Aeneas, nicht durchsetzen konnte. Dafür hat man die albanischen Könige gewählt, um die Zeit zu überbrücken. Zenk arbeitet aber auch Unterschiede zwischen dem Urvater Roms (Aeneas) und dem Stadtgründer Romulus heraus. Obwohl Aeneas in der Darstellung des Livius wie Romulus eine Apotheose erfährt (1,2,6), wird dieser Vorgang nicht genau erzählt. Lediglich der Hinweis darauf, dass er als Jupiter Indiges verehrt wird, weist auf die Vergöttlichung hin (234). Zenks Analysen lassen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Darstellungen der Geschehnisse bei Vergil und Livius erkennen. Für den Historiker spielt die pietas des Aeneas keine Rolle, wohl aber „stehen die Aitien des Friedensschlusses und des Vertragsschlusses verbunden mit dem Wert der amicitia im Mittelpunkt der Erzählung“ (234). Livius suggeriert, dass der eigentliche Gründer der Stadt Rom Romulus ist (235). Durch die knappe Erzählung der Sage des Aeneas erhielt diese Figur erheblich weniger Bedeutung für die spätere Geschichte als bei Vergil (234).
Drittes Beispiel: Coriolan als negatives Beispiel eines Patriziers, der durch einen sehr ausgeprägten Machtwillen dargestellt wird. Auch an der Episode der secessio plebis und der Rolle des Coriolan macht Zenk deutlich, wie Livius erzähltechnisch vorgeht. Er wechselt die Perspektiven, beginnend mit der auktorialen Perspektive, und berichtet dann aus der Sicht der Patrizier. Darin eingebaut wird die berühmte Fabel des Menenius Agrippa, der diese selbst erzählt (304). In diesem Zusammenhang wird auch das eingeführte Amt des Volkstribunen vorgestellt, das Coriolan bekämpft. Aber Livius unterlässt es nicht, auch die Perspektive der Plebs einzubringen. So gelingt ihm wieder die Multiperspektivität zu realisieren. Dass Livius einen aufmerksamen Leser erwartet, der größere Teile des Geschichtswerks im Blick hat, zeigt auch der Hinweis von Zenk, dass Livius mit Rückblicken arbeitet (395). Dies beweist wieder, dass unser Historiker sehr vielschichtig zu schreiben vermag.
Das umfangreiche Literaturverzeichnis enthält wichtige Titel der Forschungsliteratur (338-351). Allerdings hätte man sich auch die Berücksichtigung folgender Titel gewünscht: M. von Albrecht, Große Geschichtsschreiber, Kap. 12: Livius, Römische Wertbegriffe, dargestellt an den Anfangskapitel, in: Große römische Autoren. Texte und Themen. Bd. 1. Caesar, Cicero und die lateinische Prosa. Heidelberg 2013, 147-164 sowie Ders., Große Geschichtsschreiber, Kap. 13: Livius, Fides, Völkerrecht und ein bestrafter Schulmeister, in: Ders., a.a.O., 165-171; U. Schmitzer, Rom im Blick. Lesarten der Stadt von Plautus bis Juvenal (hier besonders die Seiten 44-54 zu Livius), Darmstadt 2016.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass J. Zenk klar nachvollziehbare Resultate vorgelegt hat. Dank der gewählten Interpretationsmethode, nämlich die primär textimmanente Perspektive, gelingt es ihm, auch unter Beachtung der Vorgaben des close reading, die Art und Weise, wie Livius die Anfänge Roms erzählt, anschaulich zu machen. Zenk berücksichtigt die aktuelle Forschungslage und bringt sie voran, geht auf die von Livius benutzten Quellen und auf entscheidende Fragen, die die Forschung aufgeworfen hat, ein. Anhand zahlreicher feinfühliger Interpretationen der wichtigsten Textstellen arbeitet Zenk die Multiperspektivität heraus, die Livius in der ersten Pentade angewandt hat. Er erleichtert dem Leser die Lektüre durch einen angenehmen sprachlichen Duktus. Denjenigen, die sich intensiv mit dem Geschichtswerk ab urbe condita befassen möchten, ist die Anschaffung des Buches zu empfehlen, auch für Lehrkräfte, die das Geschichtswerk des Livius im Unterricht behandeln wollen.

Dietmar Schmitz
Juni 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Latein. Tot oder lebendig!? Autoren: Sigrid Albert, Cornel Dora, Helga Fabritius, Adam Gitner, Ingo Grabowsky, Andreas Joch, Hendrik Köplin, Matthias Laarmann, Jürgen Leonhardt, Tino Licht, Carolin Mischer, Josef Mühlenbrock, Verena Pfaff, Hans-Walter Stork, Wilfried Stroh, Jochen Walter. Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur (Hrsg.): Lindenberg i. Allgäu 2022, Kunstverlag Josef Fink. 304 Seiten, ISBN 978-3-95976-375-2. 24,80 Euro
Die Neuerscheinung für den Monat Juni 2022 ist der Katalog zur Ausstellung „Latein: Tot oder lebendig!?“, die noch bis zum 8. Januar 2023 im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur im Kloster Dalheim (bei Paderborn) stattfindet. Das 304-seitige, fest gebundene Buch enthält einen ausführlichen Einleitungsteil mit zwölf kleinen Essays und einen Katalog, der die Exponate der Ausstellung erläutert. Der erste Beitrag, verfasst von Ingo Grabowsky, dem Direktor der Stiftung Kloster Dalheim, gibt einen an den wichtigsten Eckpunkten orientierten Überblick über die Geschichte der lateinischen Sprache, vom dritten Jahrhundert vor Christus bis zu ihrer Situation in der Gegenwart. Der zweite Beitrag, aus der Feder der Kuratorin Carolin Mischer, trägt den Titel der Ausstellung und stellt deren Konzept vor, das sich im Wesentlichen an elf Biographien orientiert: Cicero als formgebender Redner trägt das etwas eigenartige Epitheton „der Mörder“ – eine Anspielung darauf, dass er mit seiner klassischen Formung des Lateinischen den Grundstein dafür legt, dass Latein zur ‚toten‘ Sprache werden kann; es folgen Horaz, vorgestellt als „Visionär“, Augustinus als „Brückenbauer“, Karl der Große als „Wegbereiter“, Hrotsvit von Gandersheim als „Dichterin“, Hildegard von Bingen als „Posaune Gottes“, Francesco Petrarca als „Erneuerer“, Erasmus von Rotterdam als „Europäer“, Johann Amos Comenius als „Lehrer“ (mit einem Anhang über den Lateinunterricht), Wilhelm von Humboldt als „Reformer“ und Asterix als „Botschafter“. Ciceros Leben und Werk skizziert sodann Wilfried Stroh. Einen lokalen Bezug stellt der Beitrag von Josef Mühlenbrock mit einem kurzen Blick auf antikes römisches Lesen und Schreiben im Lichte archäologischer Funde aus Westfalen her. Der Rolle des Lateinischen als Sprache in den frühmittelalterlichen Klöstern illustriert insbesondere am Beispiel von St. Gallen Cornel Dora. Hans-Walter Stork erläutert die Textüberlieferung lateinischer Klassiker zwischen Spätantike und Humanismus. Tino Licht gibt unter der Überschrift „Imitation und Innovation“ einen Überblick über die mittellateinische Dichtung. Wiederum auf Westfalen bezieht sich dann der Beitrag von Matthias Laarmann, der literarische Lobpreisungen der Region aus Mittelalter und Neuzeit vorstellt. Die Geschichte des Lateinischen als internationale Wissenschaftssprache verfolgt anschließend Jürgen Leonhardt. In Kontrast dazu beleuchtet dann Adam Gitner die Rolle des Lateinischen als „erotische Sprache“ – sei es in der Liebesdichtung, sei es in den Priapeia, sei es in alltagssprachlichen Zeugnissen aus Bordellen. Die beiden letzten Beiträge sind dem Lateinischen in der Gegenwart gewidmet: Die Latinitas viva stellt Sigrid Albert vor, den Spuren von „Latein in der Populärkultur“ – zu denken ist an Werbung, Produkt- und Firmenbezeichnungen, Tätowierungen, an Spiele und Bücher, die sich mit magischen Inhalten befassen, schließlich an Übertragungen zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur ins Lateinische. Alle Beiträge sind ansprechend illustriert und mit einer kurzen lateinischen Zusammenfassung eingeleitet. Nun folgt der Katalogteil, in dem die Exponate näher erläutert werden. Gegliedert ist er, wie die Ausstellung selbst, entsprechend den elf ‚Biographien‘, die schon Carolin Mischer in ihrem Beitrag eingeführt hatte. So finden sich im ersten Teil beispielsweise Bildzeugnisse moderner Cicero-Rezeption, Handschriftenseiten aus der Überlieferung und eine römische Haarnadel als Anspielung auf die nur bei Cassius Dio (47,8,3f.) erwähnte Episode, dass Fulvia, um sich an der Rache ihres Mannes Marcus Antonius zu beteiligen, die Zunge des ermordeten Redners mit einem solchen Instrument durchstochen habe. Überhaupt nehmen Bücher und Schriftstücke einen sehr breiten Raum unter dem Ausgestellten ein. – Der Band mit seinen kurzen, aber gehaltvollen, auch für ein nicht fachkundiges Publikum gut zugänglichen Beiträgen bietet eine reizvolle Tour d’Horizon zu Geschichte und Gegenwart der (Schul-)Sprache Latein. Das Überraschende liegt eher in den Details, die hier mit leichter, sicherer Hand dargeboten werden. Grundstürzend Neues (etwa zu Latein in der digitalen Welt, zu Latein als Brückensprache usw.) sucht man ebenso vergebens, wie das weite Feld der literarischen und künstlerischen Rezeption weithin unerschlossen bleibt. Gleichwohl, das gute alte Latein ist liebevoll, lehrreich und in vielen Dingen höchst anregend dargeboten.
Stefan Freund (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
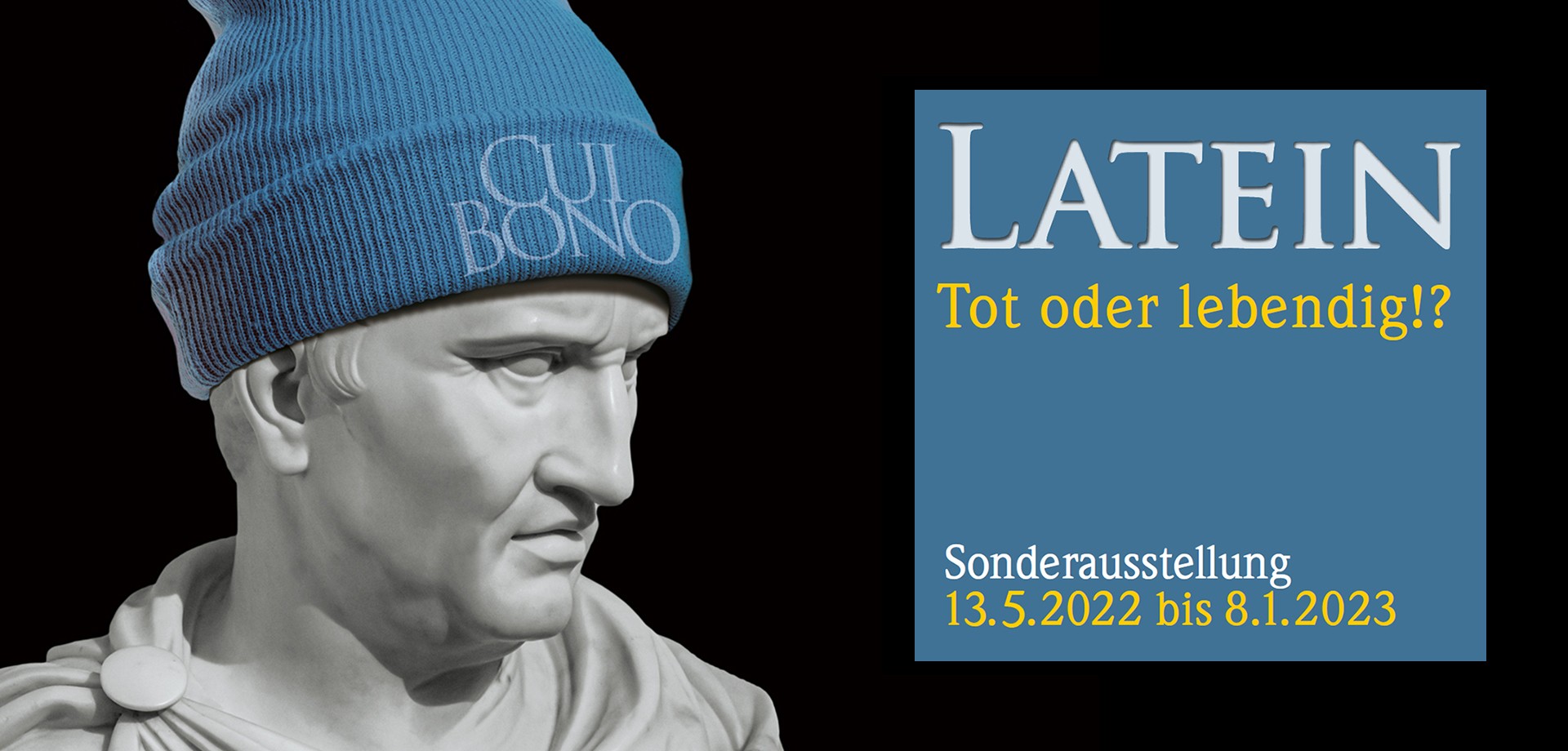
Mai 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Kurt Roeske: Ovidius perennis – unsterblicher Ovid. Verwandlungsgeschichten – verwandelte Geschichten, Würzburg: Königshausen&Neumann 2022, 289 S., 19,80 €
„Texte, Bilder und Interpretationen von der Antike bis zu Peter Härtling und Pablo Picasso“ lautet der weitere Untertitel des neuen Buches von Kurt Roeske, der in den Jahrzehnten (sic!) seit seiner Pensionierung als Schulleiter, zuletzt des Rabanus-Maurus-Gymnasiums in Mainz, eine staunenswerte Fülle an Publikationen vorgelegt hat (vgl. hier S. 289). In zwölf Kapiteln (die nicht der Anordnung Ovids folgen) behandelt R. Passagen aus Ovids Metamorphosen, indem er sie zunächst teils paraphrasiert, teils (in der im gleichen Verlag erschienenen Prosaübersetzung Hermann Heiser, 2020) zitiert. Es folgen jeweils mehrere Beispiele für das Fortwirken Ovids in der deutschen und europäischen Literatur (am meisten – sechs – für Narcissus, eines – Shakespeare – für Adonis) sowie daran anschließend für die bildliche Rezeption. Für diese Abschnitte zeichnet eine ehemalige Kollegin R.s, Evelyn Hermann-Schreiber (Kunstlehrerin und selbst Künstlerin), verantwortlich.
R. behandelt Phaethon, Proserpina, Pyramus und Thisbe, Pygmalion, Philemon und Baukis (sic), die lykischen Bauern, Erysichthon, Marsyas, Midas, Adonis, Echo und Narcissus sowie die Fama – also viele (wenn auch nicht alle) auch aus der Schulpraxis bekannte Erzählungen. Dabei greift er auch in erheblichem Maß auf die aktuelle Ovidforschung zurück, was der Behandlung ein solides Fundament gibt, ohne dass R.s eigener Zugriff dahinter verschwinden würde.
Beim Raub der Proserpina führt R. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller („Klage der Ceres“) und die Schillerparodie Heinrich Heines, außerdem die Anverwandlungen des 20. Jahrhunderts bei Christoph Ransmayr und Yvan Goll. Das Vorgehen entspricht weitgehend dem bei der Vorstellung der ovidischen Version: eine Mischung aus Paraphrase, Zitat und einigen deutenden Hinweisen. Als Dokumente aus der Kunstgeschichte stellt Evelyn Hermann-Schreiber Albrecht Dürers Kupferstich und Gian Lorenzo Berninis Skulptur in der Galleria Borghese, die – wie auch sonst – immer erst einmal formal beschrieben und dann vorsichtig gedeutet werden. Bild (soweit möglich: in Farbe) und Text sind prinzipiell synoptisch angeordnet und ermöglichen damit den unmittelbaren Vergleich. Dieses durchgängig eingehaltene Verfahren ermöglicht es den Leser:innen, sich rasch in den jeweiligen Kapiteln zurecht zu finden. Und sie treffen auf alte Bekannte, die „big names“ der Ovid-Rezeption (Shakespeare, Goethe, E.T.A. Hoffmann oder George Bernard Shaw in der Literatur, Rubens, Poussin, Waterhouse, mehrfach Picasso in der Kunstgeschichte). Ergänzt wird das um den Hinweis auf Ferdinand von Schirachs Adaption der Pygmalion-Sage (2018) sowie eine das Pyramus-und-Thisbe-Motiv aufgreifende Erzählung des Übersetzers Hermann Heiser (2020).
Aber auch wenn vieles, was R. und seine Kollegin anführen, bekannt ist, so ist es sehr erfreulich, diesen Überblick nicht nur als Katalog, sondern in zusammenhängend lesbarer Form vor sich zu haben und damit die Fülle der literarischen und künstlerischen Ovid-Rezeption vor Augen geführt zu bekommen. Auf diese Weise kann das Buch auch Anregungen für die schulische und universitäre Unterrichtspraxis liefern, wobei dann die Aufgabe bei den entsprechenden Lehrenden bleibt, das Verhältnis zwischen Ovid und seinen Nachfolgern genauer analytisch zu fassen, etwa mit den Mitteln der Rezeptions- und Transformationstheorie. Und nicht zuletzt ist es schön zu sehen, dass R. mit sichtlicher Freude an seinem Gegenstand schreibt und dass es ihm ein tiefes Anliegen ist, den „unsterblichen Ovid“ auch tatsächlich im Gedächtnis der Nachwelt am Leben zu halten.
Das Buch wird abgeschlossen durch einen Katalog von „Beispielen für Rezeption der Mythen in der Musik“ (273-274), einen Bildnachweis, der auch als eine Art von Katalog dienen kann, sowie eine thematisch gegliederte Bibliographie.
Ein Hinweis noch auf einen echten Irrtum: Das Fresko mit Pyramus und Thisbe aus Pompei (75) stammt natürlich nicht aus dem 3. Jh. n.Chr., denn da hatte der Vesuv schon gut zweihundert Jahre zuvor dafür gesorgt, dass es für lange Zeit nicht mehr sichtbar war. Aber das nur der Vollständigkeit halber, nicht um dem Buch in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen.
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
April 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Armin Eich: Die Verurteilung des Krieges in der antiken Literatur, Münster: Aschendorff 2021, 275 S., 36, -- €
Dass Bücher ihr eigenes Schicksal haben, ist ein beinahe zu Tode zitierter Gemeinplatz (Terentianus Maurus: habent sua fata libelli). Doch im Falle von Armin Eichs Buch hat die Sentenz erschreckende Wahrheit gewonnen, denn wenige Monate nach der Veröffentlichung (und während diese Zeilen geschrieben werden) ist der Krieg im Herzen Europas angekommen, hat der von Wladimir Putin angeordnete Überfall auf die Ukraine die Frage nach Krieg und Frieden sowie der Haltung zu dieser Frage aus der Theorie in die Wirklichkeit geholt. Insofern ist die Lektüre auch ein Musterbeispiel für die Rezeptionsgeschichte, nämlich dafür, wie die jeweiligen aktuellen Kontexte die Lektüre leiten.
Armin Eich, Professor für Alte Geschichte an der Universität Wuppertal, hat weder ein pazifistisches Manifest geschrieben noch einfach eine als Kopiervorlage geeignete Anthologie von antiken Friedenstexten. Sein teils im Detail interpretierendes, teils umfangreichere literatur- und geistesgeschichtliche Epochen paraphrasierendes Buch ist durchaus komplex, so komplex wie das Thema, und zugleich herausfordernd (auch zum Widerspruch – dazu später mehr). Und das ist auch gut so: Denn selbst die beste Sache verträgt keine simplifizierende Reduktion auf ein moralisch einwandfreies, aber unterkomplexes Schwarz-Weiß.
Das erste Kapitel (12-22) ist gleich ein Meisterstück und behandelt Thersites, der im zweiten Buch von Homers Ilias als pedestrer Gegner der griechischen Heerkönige eingeführt wird. Sein Aufruf, die der Wortwahl kaum von derjenigen großer griechischer Heerführer, die in Momenten der Verzweiflung durchaus auch ihrerseits über den Abbruch des Krieges räsonierten. Aber die persönliche Disqualifizierung als neidisch, zänkisch und eben nicht ebenbürtig disqualifiziert auch seine Argumente, und das nicht nur in der Erzählung der Ilias, sondern auch in der Rezeption bis in unsere Tage (besonders bezeichnend ist das Verdikt des Aristokraten Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff über „die giftige Kröte, die ihren Geifer gegen die Besten spuckt“).
Diese Buchvorstellung soll ja nicht die eigene Lektüre ersetzen, deshalb will ich hier die Themen eher summarisch nachzeichnen (dieser Beschränkung fallen auch Isokrates und Dion sowie die spätantike Historiographie zum Opfer). Mit unverkennbarer Sympathie beschreibt Eich die Auffassung des Empedokles, der Friede gehöre genuin zur kosmischen Ordnung (23-31). Daran schließt sich der Blick auf die hellenistische Philosophie (einschließlich Lukrez) an und geht dem menschheitsgeschichtlichen Bild von der (verkürzt gesagt) ursprünglichen Golden Zeit und der Herrschaft der Dike nach (32-46). Das Thema greift Eich gegen Ende des Buches noch einmal auf, wenn er den im 4. Jahrhundert n.Chr. wirkenden Pythagoreer Iamblichos und dessen „Projekt eines allgemeinen Weltfriedens“ vorstellt (245-254).
Das athenische Drama ist mit Euripides (47-64) und Aristophanes (65-75) vertreten. Die Troierinnen und die Helena geben den kriegskritischen Stimmen von Sklaven und Frauen ein Forum, doch bezweifelt Eich, dass das männliche Publikum sich davon wirklich beeindrucken ließ. Den Herakles liest er als dramatisierte Pathologie von Gewalterfahrungen und Gewaltphantasien, wie sie auch in der Gegenwart sogar in Amokläufen endeten. Nicht ganz so gut wie die subtilen, gegen den athenischen main stream angehenden Friedensbotschaften des Euripides kommen die Stücke des Aristophanes weg, mag darunter auch der Frieden sein, da sich darin keine prinzipielle Absage an den Krieg fänden, sondern nur jeweils sich aus der Komödienkonstellation ad hoc ergebende.
An der Stoischen Philosophie (83-101) werden vor allem ihre friedliebenden Anfänge (namentlich durch den Schulgründer Zenon) hervorgehoben, während bei späteren, dank des Überlieferungsschicksals wirkmächtigeren Autoren (u.a. Cicero) die Gedankengänge vergröbert oder gar entstellt worden seien – nur Seneca geht als positive Ausnahme durch. Auch die augusteische Dichtung (102-136) erfährt durchaus Kritik, da sie insgesamt zu nahe an Augustus und der römischen Ideologie der Expansion des Reiches durch Angriffskriege sei. Die vorbehaltlos gewürdigte Ausnahme ist Tibull, vor allem sein Pax-Hymnus (Tib. 1,10), der gerade vor dem Hintergrund der Kriegszüge, an denen Tibull in der Entourage des Messalla gezwungenermaßen teilnahm, seine aktuelle Signifikanz erhält. Aber selbst Tibull muss sich anhören, dass seine Haltung zum Krieg individualistisch sei und nicht darauf abziele, weitere Kreise gegen das Militärische zu mobilisieren, und er aus der bequemen Sicherheit der Parkanlagen und Villen schreibe, nicht als Existentiell Betroffener.
Für die neronische Literatur (137-151) befasst sich Eich mit der bukolischen Poesie, Lucans Pharsalia (Singular, nicht Plural!) sowie Petrons Satyrica. Auch wenn Calpurnius Siculus die neue Goldene Zeit mit der Regierung Neros heraufziehen sieht, so ist doch die damit verbundene Friedensvision sehr nahe an entsprechenden biblisch-alttestamentarischen Vorstellungen wie bei Jesaja und Micha – näher, so Eich, als Vergils vierte Ekloge. Lucan attestiert er, dass er zwar intensive und schreckliche Kriegsbilder liefere, aber nicht aus einer prinzipiellen Ablehnung des Krieges heraus, sondern nur (oder „nur“?) weil die falsche Seite gesiegt hat. Der Gegentext dazu sei das in die Satyrica eingelegte, von Eumolp vorgetragene Bellum Civile, ein - so Eich – der härtesten Abrechnungen mit dem Imperialismus, da Krieg und Bürgerkrieg nicht durch fehlerhaftes individuelles Verhalten entstanden seien, sondern die unausweichliche Konsequenz der römischen Expansion.
Spannend ist der Umgang der Christen mit dem Themenkomplex Krieg und Militär (drei Kapitel: 161-244). Bis zur Konstantinischen Wende ist die Frage nach der christlichen Haltung dazu zwar eher marginal, aber doch recht eindeutig: Auch wenn es – in der Paulinischen Tradition der Staatsbejahung – keinen Aufruf zur massenhaften Kriegsdienstverweigerung oder Desertion gibt, so ist das militärische sacrarium im Sinne des Ersten Gebotes hochproblematisch (besonders dezidiert äußert sich Tertullian dazu). Darüber hinaus gehen die christlichen Autoren in der Fortsetzung alttestamentarischer Friedensentwürfe davon aus, dass Kriege ein Zeichen dafür sind, dass die Welt eben noch defizitär und das kommende Friedensreich noch nicht Realität geworden ist. Doch kaum haben sich die Machtverhältnisse geändert, ändert sich auch die Haltung von christlichen Autoren – ganz besonders deutlich am Beispiel des Lactanz auf dem Weg von Divinae Institutiones zu De mortibus persecutorum, von der Erfahrung der Ungerechtigkeit und des Leidens hin zum unbedingten Vernichtungswillen gegen die, die er als Feinde des Christentums sieht – si verbis audacia detur: vom Paulus zum Saulus.
Gegen die mit der neuen Einheit von Christentum und Macht einhergehende Befürwortung von Militär und Krieg als machterhaltendes, positiv zu sehendes Moment erhoben sich nur wenige Stimmen. So sind sowohl die Vita des Mönches Panchomius als auch die Acta Archelai von einer tiefen Skepsis gegenüber Soldatischem geprägt, ganz zu schweigen davon, dass Basilius Soldaten auf eine Stufe mit Mördern stellte, da ein Schwert nun einmal eine Mordwaffe sei. Dem schloss sich auch Paulinus von Nola an. Doch stammen diese antimilitärischen Stimmen von Autoren, die keine institutionelle Karriere anstrebten und deshalb auch keinen tatsächlichen Einfluss auf staatlich-kirchliche Entscheidungen hatten. Das stellte sich für Augustinus schwieriger und differenzierter dar, denn enthält De civitate dei die umfangreichste christliche Abrechnung mit der römischen Pazifizierungspolitik und die Absage an die militärische Durchsetzung von imperialen Ambitionen. Solange aber die göttliche universelle Ordnung noch nicht erreicht ist, können auch Friedliebende dazu gezwungen werden, zu den Waffen zu greifen. Der von Eich S. 238 zitierte Satz ist im Frühjahr 2022 von geradezu erschreckender Aktualität: iniquitas enim partis adversae iusta bella ingerit gerenda sapienti.
Wenn man das Buch als groß angelegten Überblick über das Friedensthema von Homer bis zur Spätantike liest, ist man überaus beeindruckt von der Weite des Blicks aber auch vom Mut des Verfassers, sich auf ein solches Unternehmen einzulassen. Wenn man konkrete Auskunft zu einzelnen Epochen oder Autoren sucht, stellt sich die Sache differenzierter dar und es gibt sehr wohl Aspekte, die zum Widerspruch herausfordern (einiges dürfte schon aus meinem bisherigen Referat spürbar geworden sein), etwa die eher aleatorische Auswahl der angeführten Forschungsliteratur oder die häufig zu verspürende Tendenz, den Autor mit seinem Text gleichzusetzen oder. Für letzteren Aspekt ein Beispiel aus dem Abschnitt über Ovid (der ganz offenkundig nicht zu Eichs Lieblingsautoren gehört): Wenn Eich dem (für sich genommen in der Tat ziemlich martialischen) Distichon Ov. fast. 5,59-60 attestiert, es schmecke „schon ziemlich nach Reichsparteitag“ (S. 135), und darin einen Beleg dafür sieht, dass der Dichter auf seine alten Tage sich zu patriotischer Größe aufgeschwungen habe, dann darf man dagegenhalten: Dieses Lob des Mars ist Teil der Diskussion um die Bedeutung des Monatsnamens Mai, die von drei Musen (Polyhymnia, Urania, Calliope) geführt wird und die (anders als beim Venusmonat April) auch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt. Vielmehr bleibt der Erzähler der Fasti am Ende ratlos zurück und weiß nicht, ob er einer der Musen oder überhaupt keiner glauben darf. Die inkriminierten Verse kommen also gerade nicht mit auktorialer Beglaubigung daher, sondern sind einer dezidiert als unzuverlässig angeführten Quelle in den Mund gelegt (vgl. etwa die ausführliche Behandlung der Passage bei Johanna Löhr, Ovids Mehrfacherklärungen in der Tradition aitiologischen Dichtens, Stuttgart/Leipzig 1996, 214-291). Es ist eben nicht so einfach mit der Gesinnung Ovids und überhaupt der Dichter. Dies ist ein Beispiel dafür (und gerade im Abschnitt über die augusteische Literatur finde ich eine Reihe davon), wie man mit gutem Grund auch deutlich anderer Meinung sein kann als Eich, ohne dass dadurch die Argumentation in Bausch und Bogen verworfen werden müsste.
Im Gegenteil: Das was Eich auf der letzten Seite seiner Darstellung schreibt, verdient vorbehaltlos unterstrichen und verbreitet zu werden (270): „Dieses Buch sollte vor allem daran erinnern, dass trotz aller Skandalisierung und Tabuisierung im griechischen und römischen Altertum Menschen den Mut gefunden haben, dem Krieg als menschlicher Aktionsform eine Absage zu erteilen.“ Ob das so entstandene Corpus im Lateinunterricht Caesar ersetzen soll (so der abschließende Satz Eichs) oder ob man es nicht auch aushalten muss, dass die Römer (und Griechen) nicht in allen Belangen untadelig und vorbildlich sind und dass das auch im altsprachlichen Unterricht abzubilden ist – das ist eine so alte wie immer neu zu führende Diskussion – ein weites Feld.
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

März 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Hartwin Brandt, Handbuch der Altertumswissenschaft III, 11. Die Kaiserzeit. Römische Geschichte von Octavian bis Diocletian. 31 v. Chr. – 284 n. Chr. C. H. Beck: München 2021. 707 S. 98 EUR (ISBN: 978-3-406 77502 4).
Hartwin Brandt, ordentlicher Professor für Alte Geschichte an der Universität Bamberg, hat sich der mühevollen Arbeit unterzogen, das Handbuch der Altertumswissenschaften für die Römische Kaiserzeit neu zu verfassen. Es steht in der Tradition mehrerer von Hermann Bengtson verfassten Handbücher. Sehr zu begrüßen ist, dass der Verfasser die Möglichkeit erhielt, am Institute for Advanced Study in Princeton mehrere Monate im Jahr 2015 und während des akademischen Jahres 2017/2018 an dem Handbuch zu arbeiten. Außerdem förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Projekt, indem es eine Freistellung von allen Lehrverpflichtungen unterstützte (Oktober 2019 bis September 2020). Ohne derartige Förderungen ist es kaum möglich, ein solches Handbuch zu verfassen. Gleich zu Beginn des Vorworts richtet Hartwin Brandt Dankesworte an den Kölner Althistoriker Werner Eck, der das Manuskript begutachtet und sorgfältig studiert hat. Eck gilt als einer der profiliertesten Forscher der römischen Kaiserzeit. Im Literaturverzeichnis gibt es auf 4 Seiten Hinweise auf seine Publikationstätigkeit. Hartwin Brandt verfügt über immense Kenntnisse der gesamten römischen Kaiserzeit, denn er hat zwei Monographien über die Zeit von Diokletian bis zum Ende der konstantinischen Dynastie (284-363) (Berlin 1998) und über das Ende der Antike (München 2001) verfasst.
In der Einleitung (1-12) erläutert Hartwin Brandt seine Konzeption des Handbuchs. En passant erfährt der Leser, dass der spätere Kaiser Augustus sich nie Octavianus nannte, sondern nur Caesar. Gleich hier wird deutlich, dass sich Hartwin Brandt einerseits auf die antiken Quellen stützt, andererseits die aktuelle Forschungslage sehr gut kennt und für das Handbuch aufbereitet hat. Er möchte aber nicht „primär Zahlen, Daten und Fakten, also eine Summe und Ausbreitung sämtlichen verfügbaren positiven Wissens über die inneren und äußeren Geschehnisse und Verhältnisse zur Zeit des römischen Kaiserreiches“ bieten (5). Hartwin Brandt beabsichtigt „kein lexikonartiges Nachschlagewerk“ vorzulegen (5), „sondern eine in sich stimmige, durch ein stringent verfolgtes, argumentatives Konzept konsistente Gesamtdarstellung“ (5). Um es vorweg zu nehmen kann der Rezensent bereits an dieser Stelle mitteilen, dass Hartwin Brandt sein Ziel erreicht hat. Er erläutert auch, warum er Strukturen, Verhältnisse und Veränderungen in den Städten und Provinzen unberücksichtigt gelassen hat, die die Kaiser selten oder gar nicht aufgesucht haben (4). Vielmehr „setzt die vorliegende Darstellung auf ein variables, für die verschiedenen Kaiser je nach Überlieferungslage flexibel zu realisierendes, integriertes Konzept von Herrschaftsgeschichte, gelegentlich auch von Sozial-, Wirtschaft-, Kultur und Mentalitätsgeschichte, vor allem aber: auf die Analyse von Kommunikation und soziopolitischer Interaktion im weitesten Sinne“ (4). Hartwin Brandt erhebt keinen Totalitätsanspruch, sondern wählt je nach Bedarf aus dem breiten Spektrum an literarischen, epigraphischen, papyrologischen, numismatischen Quellen und archäologischen Denkmälern aus. Er rechtfertigt den Anfangspunkt, den das Jahr 31. v. Chr. darstellt, sowie das Jahr 284 n. Chr. als Schlussakkord (6f.). In dieser Rezension geht es nicht darum, viele Details aus dem Buch von Hartwin Brandt anzuführen oder gar zu kommentieren, vielmehr soll sie einige wichtige Eindrücke und einen Einblick gewähren - exemplarisch an drei Kaisern - wie der Verfasser des Handbuchs konzeptionell vorgegangen ist. Wenn der Autor eines Handbuchs wesentliche Erkenntnisse des aktuellen Forschungsstandes vermitteln soll, so ist es ihm gleichwohl gestattet, eigene Akzente zu setzen, auch bei der Wahl bestimmter Begriffe. So lehnt Hartwin Brandt die von Egon Flaig präferierten Ausdrücke „Akzeptanzsystem“ und „Akzeptanzmonarchie“ ab (9), sondern hat einen etwas schwerfällig anmutenden Ausdruck kreiert, nämlich: „Akzeptanzbedürfnissystem“ (9). Er meint damit folgendes: Realiter gab es keine Bemühungen, den von Augustus konzipierten Prinzipat zu verändern und eine neue Ordnung zu schaffen, „vielmehr waren es die individuellen Principes, welche in unterschiedlicher Art und Weise Akzeptanz für die eigene Person, ihre Familie und ihre besondere Form der Ausübung der Leitungsfunktion herstellen und erhalten mussten und dabei gelegentlich auch scheiterten“ (9).
Um die Akzeptanz der unterschiedlichen Gruppierungen in der damaligen Gesellschaft zu erreichen, war der jeweilige Prinzeps zur Kommunikation gezwungen. Diese beiden Kategorien gemeinsam mit den bereits angeführten verschiedenartigen Quellen sind die entscheidenden Merkmale dieses Handbuches.
Bevor ich auf die drei Kaiser (Augustus, Tiberius, Mark Aurel) zu sprechen komme, möchte ich einen kurzen Überblick über das Buch bieten. Der Aufbau richtet sich erwartungsgemäß nach chronologischen Gesichtspunkten. Im ersten Kapitel liefert Hartwin Brandt Informationen über die vorhandenen Quellen (13-35). Der erste Teil besteht aus einem Überblick, im zweiten Teil stellt er einzelne Autoren vor (21-34), von Aelius Aristides (21) bis Zosimos (34). Eine solche Übersicht ist für den Nutzer des Handbuchs hilfreich, denn er erfährt nicht nur grundlegende Informationen über die Autoren, sondern auch über wichtige Textausgaben und deutsche Übersetzungen. Im zweiten Kapitel wendet sich Hartwin Brandt dem ersten Kaiser der römischen Geschichte zu, nämlich Augustus (35-115), um sich im dritten Kapitel mit der julisch-claudischen Dynastie zu befassen (116-213). Die Repräsentanten dieser Epoche sind Tiberius (116-147), Caligula (147-168) und Nero (168-213). Das vierte Kapitel thematisiert das Vierkaiserjahr 68/69 n. Chr. (214-233). Danach stehen im fünften Kapitel die Flavier im Vordergrund (234-284). Die Adoptivkaiser sind die Hauptakteure der Zeit von 96 bis 180 n. Chr. (285-402). Die wichtigsten Kaiser waren Traian, Hadrian und Mark Aurel. Im siebten Kapitel stehen das Ende der Zeit der Adoptivkaiser und die Epoche der Severer im Fokus (403-481). Der Titel des achten Kapitels lautet: „Krise oder Transformation? Die Zeit der Soldatenkaiser (235-284) (482-585).
Der Anhang (589-707) enthält Karten, eine Zeittafel, Stammtafeln, Angaben zu Abkürzungen und ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis. Den Abschluss bilden das Stellenregister, das Personenregister sowie das allgemeine Register. Auch wenn das Literaturverzeichnis (619-670) sehr viele Titel enthält, stellt sich für den Autor stets die Frage, welche Publikationen aufgenommen werden und welche nicht. Diese Auswahl ist stets subjektiv, von einem Handbuch darf man aber erwarten, dass die entscheidenden Veröffentlichungen aufgeführt sind. Insgesamt hat Hartwin Brandt meines Erachtens maßgebliche Werke berücksichtigt.
Am Anfang des Kapitels über Augustus beginnt Hartwin Brandt mit Hinweisen auf die umfangreiche Quellenlage, die zu diesem Kaiser existiert, worauf der Autor ausführlich eingeht. Zunächst vermittelt er Informationen zu den antiken Quellen wie Sueton, Nikolaos von Damaskus, Velleius Paterculus, Flavius Josephus und vor allem Cassius Dio. Von großer Bedeutung, wenn auch teilweise einseitig, sind die zahlreichen Bemerkungen des Tacitus, und dies nicht nur im Fall des Prinzeps. Immer wieder greift Hartwin Brandt auf die Schrift des Augustus: Res gestae zurück. Vergessen werden auch nicht die augusteischen Dichter wie Vergil und Horaz. Besonderes Augenmerk verdienen nach Hartwin Brandt die zahlreichen Inschriften, die gerade im Zusammenhang mit der „medialen (Selbst-)Darstellung des Princeps und seine kommunikativen Intentionen, für den gesamten Komplex der Neuordnung der Verwaltung, die Prosopographie der senatorischen und ritterlichen Eliten und die Militärreformen“ stehen (35). Der erste Abschnitt des ersten Kapitels stellt die Bedeutung der Schlacht von Actium (31 v. Chr.) heraus; hierbei prüft Hartwin Brandt genau die antiken Quellen und gleicht sie mit den Befunden moderner Historiker ab. Werner Eck wurde bereits erwähnt, auch das zu einem Standardwerk avancierte Buch von Dietmar Kienast (Augustus. Prinzeps und Monarch. Darmstadt 1982, 42009 [nicht berücksichtigt hat Hartwin Brandt die 5. Auflage, Darmstadt 2014]) wird immer wieder zitiert.
Er zeichnet die weitere Entwicklung der folgenden Jahre genau nach, vor allem wie Augustus den Spagat geschafft hat, den Anschein zu erwecken, die alte res publica wieder herzustellen, und gleichzeitig seine Vormachtstellung als Prinzeps geschickt zu kaschieren. Dazu gelang es dem Herrscher, den einzelnen gesellschaftlichen Gruppierungen geschickt ihre jeweiligen Rollen zuzuordnen. Allerdings lässt sich nicht behaupten, dass Augustus von Anfang an gewusst hätte, wie sich das neue System des Prinzipats realisieren ließ, sondern es handelte sich um eine dynamische Entwicklung. Dabei war entscheidend, dass der Nachfolger Caesars allgemeine Akzeptanz erzeugte. In den sich daran anschließenden Abschnitten geht Hartwin Brandt näher auf die Krisen und Auswege, auf die Pax Augusta und auf das Verhältnis des Augustus zum römischen Reich ein. Dieser Kaiser verstand es meisterhaft, sich selbst öffentlich wirksam darzustellen bzw. darstellen zu lassen. Paul Zanker hat uns in seinem wegweisenden Buch erläutert, dass Augustus erkannt hat, welche Wirkung Bilder auf seine Zeitgenossen erzielten (Augustus und die Macht der Bilder. München 1987). Hartwin Brandt entwirft eine lebendige Skizze vom Leben des Kaisers, der immer wieder erfahren musste, dass ein möglicher Nachfolger verstarb, bis schließlich die Wahl auf Tiberius fiel, eine Person, die Augustus offensichtlich nicht für geeignet hielt. Die Rolle von Individuen wird beleuchtet, stets unter Rückgriff auf die antiken Quellen und die moderne Forschung. In Fällen, in denen die Sachlage nicht eindeutig ist, benennt Hartwin Brandt diesen Umstand. Als Beispiel möchte ich den Ort der Varus-Schlacht anführen, den manche Historiker und Archäologen in der Nähe von Kalkriese vermuten. Hartwin Brandt verweist auf die entscheidenden antiken Quellen und auf die jüngsten Studien zu diesem Thema und benutzt dabei das Wort „vielleicht“ (69). An mehreren Stellen seiner Ausführungen hebt er darauf ab, dass Augustus gezwungen war, die Vertreter wichtiger gesellschaftlicher Gruppen wie Senatoren, Ritter und Eliten in den Provinzen „als repräsentationsorientierte Statusgruppen“ ernst zu nehmen und „an der politisch-militärischen Praxis“ zu beteiligen, ohne die eigene Machtposition in Gefahr zu bringen (72). Ihm ist es nach Hartwin Brandt auch gelungen, „dass der Princeps die für ihn unverzichtbare Verfügungsgewalt über die militärischen Ressourcen in republikanische Formen“ zu kleiden (72). Ein wesentliches Moment der Selbstdarstellung manifestiert sich in der Bautätigkeit, die bereits beim jungen Prinzeps zu beobachten ist. Dem hat schon Sueton Rechnung getragen, als er feststellte, dass Augustus eine Stadt aus Marmor hinterlassen habe, während er eine aus Ziegeln vorgefunden habe (Suet. Aug. 28,3). Hartwin Brandt liefert einige Details dieser Bautätigkeit, wobei der Abschnitt den Titel: Die Monarchisierung des Stadtbildes trägt (98-108). Er skizziert im Anschluss daran die Ideologie des augusteischen Prinzipats und stellt die von Augustus bevorzugten Götter vor (109-115). Der Verfasser des Handbuchs zeichnet ein eindrucksvolles Bild des Kaisers Augustus nach, ohne dessen Schwächen auszublenden. Im Gegensatz zu einigen antiken Autoren entsteht kein einseitiges Bild des Begründers des Prinzipats. Auf Gegenwartsbezüge und Vergleiche mit aktuellen Herrschern verzichtet Hartwin Brandt. Ihm geht es darum, ein umfassendes Bild des Herrschers dem Leser zu vermitteln.
Im Falle des Tiberius ist die Quellenlage besonders gut. Tacitus, Cassio Dio, Sueton und Velleius Paterculus seien als Autoren genannt, die Einzelheiten zu Leben und Tätigkeit des Nachfolgers von Augustus vermitteln. Hartwin Brandt weist ausdrücklich auf die große Bedeutung der epigraphischen Dokumente hin und nennt zum Beispiel die Tabula Hebana, die Tabula Siarensis sowie das senatus consultum de Cn. Pisone patre (116/117). Im Gegensatz zu Augustus wird Tiberius meist negativ beurteilt, außer bei Velleius Paterculus. Den Quellen nach galt dieser Kaiser als Nachfolger nur als zweite Wahl, Augustus hatte sich eigentlich seine beiden Enkel und Adoptivsöhne C. und L. Caesar gewünscht, die aber frühzeitig starben. Obwohl Tiberius nach Aussagen des Tacitus die Taten und Worte des Augustus wie ein Gesetz beachtete (Tac. Ann. 4,37,3), gelang es ihm nicht an die Erfolge seines Vorgängers anzuknüpfen. Vor allem schaffte er es nicht, allseitige Akzeptanz zu erfahren. Auch Tiberius machte sich früh Gedanken über seinen Nachfolger, aber sowohl Germanicus als auch sein Sohn Drusus (minor) Caesar verstarben. Im Falle des letzteren gab es Gerüchte über eine Vergiftung durch den eigenen Vater, aber die antiken Quellen schlossen auch einen natürlichen Tod nicht aus (132). Tacitus und Cassius Dio überlieferten die Nachricht, Livilla, die Frau des Drusus, sei gemeinsam mit ihrem Liebhaber, dem Prätorianerpräfekten L. Aelius Seianus, für den Tod des Tiberius verantwortlich (132). Dieser war nach dem Rückzug des Kaisers auf die Insel Capri (26 n. Chr.) der einflussreichste Politiker in Rom gewesen (133-145). Ob er an einer Verschwörung gegen Tiberius beteiligt war, ist für Hartwin Brandt nicht plausibel, obwohl mehrere antike Autoren darüber berichten (Sueton, Josephus Flavius, 144). Das Bild dieses Kaisers ist ambivalent, er hatte vor seinem Amtsantritt beachtliche militärische Erfolge zu verzeichnen, auch in der Verwaltung der Provinzen kann man ihm erfolgreiches Wirken attestieren. Obgleich er die letzten 11 Jahre seines Lebens nicht in Rom weilte, sondern auf Capri, hat er seine Regierungsgeschäfte nicht vernachlässigt. Die Gründe für seine negative Beurteilung der meisten antiken Autoren sind vielfältig. Hartwin Brandt vertritt die Auffassung, Tiberius habe „die Möglichkeiten, über eine anspielungsreiche Baupolitik eine eigene «imago» zu entwickeln und damit die eigene Herrschaft in besonders eindringlicher Weise zu legitimieren, nicht genutzt“ (141). Er arbeitet deutlich heraus, dass Tiberius nicht in der Lage war, angemessen mit den verschiedenen einflussreichen gesellschaftlichen Gruppierungen zu kommunizieren. Palastintrigen, die bereits erwähnte Verschwörung des Seianus und die Beseitigung römischer Senatoren in zahlreichen Majestätsprozessen (136) sind weitere mögliche Gründe für die Ablehnung dieses Herrschers. Vergessen darf man indes nicht, dass Tiberius nicht nur Senatoren zu seinen Freunden (amici) zählte, sondern auch Ritter und Personen „unterhalb der aristokratischen Ebene wie den Astrologen Ti. Claudius Thrasyllus“ 135). Hartwin Brandt geht auch den überlieferten Umständen des Todes von Tiberius nach und wertet zu Recht die Quellen behutsam aus. Dass die römische Bevölkerung angeblich den Wunsch gehabt habe, Tiberius in den Tiber zu werfen (Tiberium in Tiberim! Suet. Tib. 75,1), könnte ein Indiz dafür sein, dass er die Akzeptanz des Volkes komplett verloren hatte.
Insgesamt wägt Hartwin Brandt die Informationen der unterschiedlichen antiken Quellen unter Berücksichtigung der neueren Forschung angemessen ab. Die jüngst erschienene Studie von Holger Sonnabend (Tiberius, Kaiser ohne Volk. WBG: Darmstadt 2021) konnte er allerdings noch nicht einsehen. Michael Mause macht darauf aufmerksam, dass Holger Sonnabend davor warnt, die einseitige kritische Perspektive der genannten Autoren auf Tiberius einfach zu übernehmen, sondern den Rat erteilt, „zwischen den Zeilen zu lesen“ (Michael Mause in seiner Rezension zum Buch von H. Sonnabend, in: Forum Classicum, Heft 3, 2021, 229).
Ich komme nun zum dritten Kaiser, über den einige Beobachtungen im Handbuch getroffen wurden: zu Mark Aurel. In diesem Fall gibt es ebenfalls eine gute Quellenlage und zahlreiche Veröffentlichungen, auch aus jüngster Zeit. Neben Cassius Dio sind als weitere Quellen die Historia Augusta, Fronto und Eusebius zu nennen. Auch Herodian liefert interessante Details zum Leben des Mark Aurel. Hartwin Brandt hat aus gutem Grund die antiken Quellen zu Lucius Verus berücksichtigt, der einige Jahre gemeinsam mit seinem Adoptivbruder und Schwiegervater als Kaiser bis zu seinem Tod mitregierte (bis 169 n. Chr.), in Form eines Doppelprinzipats, der auch als Samtherrschaft bezeichnet wurde (380ff.). Nicht zuletzt wegen seines philosophischen Werks: Selbstbetrachtungen haben bereits die Zeitgenossen Mark Aurel respektiert und bewundert. Er genoss sogar hohe Verehrung. Hartwin Brandt weist mit voller Berechtigung darauf hin, dass auch andere Facetten beachtet werden sollten. „Mark Aurel war so wenig ein dem Kriegsgeschehen abgeneigter, vergeistigter Philosophenkaiser wie Antoninus Pius ein pazifistisch gesonnener Friedensherrscher. Die bereits in der antiken Geschichtsschreibung verbreitete und in der modernen Forschung bisweilen geteilte Neigung, Mark Aurels Selbst- und Rollenverständnis als Kaiser mit Hilfe seiner «Selbstbetrachtungen» und zeitgenössischer philosophischer Anschauungen zu bestimmen – hier wäre vor allem die «Zweite Sophistik» zu nennen – führt zu Fehleinschätzungen“ (383). Quellen wie Inschriften, Münzen und archäologische Denkmäler beweisen, dass Mark Aurel durchaus seine Aufgaben im militärischen Sektor wahrgenommen hat (383/384). Hartwin Brandt arbeitet einerseits markante ältere Publikationen in seine Darstellung ein, wie etwa die bedeutende Studie von A.R. Birley (Marcus Aurelius. A Biography. 2. Aufl. London 1987), andererseits aber auch Veröffentlichungen jüngeren Datums (Klaus Rosen, Marc Aurel. Reinbek 1997; Jörg Fündling, Marc Aurel. Darmstadt 2008; Alexander Demandt, Marc Aurel. Der Kaiser und seine Welt. München 2018). Wie auch bei den anderen Kaisern greift Hartwin Brandt nicht nur auf literarische Quellen zurück, sondern auch auf numismatische, archäologische und weitere Dokumente wie Kunstwerke zurück. Ähnlich wie Augustus verstand es Mark Aurel meisterhaft, sich in Szene zu setzen und mit seinen Zeitgenossen angemessen und erfolgreich zu kommunizieren. So wurde er von Senat und Volk in einer Inschrift (CIL 6, 1014) als größter Imperator gerühmt (391). Seine Akzeptanz stand außer Frage.
Hartwin Brandt legt ein äußerst wichtiges und nützliches Instrumentarium für diejenigen vor, die sich mit der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diocletian intensiv auseinandersetzen möchten. Ihm ist es gelungen, ein sehr gut lesbares Handbuch zu verfassen, in dem er zu vielen Details eine klare Position bezieht und eine eindeutige Wertung vornimmt. Hartwin Brandt gebührt größte Anerkennung für seine Zeit und Mühe, die er für die Publikation eines solchen Opus auf sich genommen hat. Wie auch die anderen Handbücher dieser Reihe kann man in diesem Werk faktensichere Informationen abrufen, die auf einer soliden wissenschaftlichen Basis beruhen. Dank gebührt auch dem Lektorat des C. H. Beck Verlages für die äußerst akribische Drucklegung. Die Anschaffung dieses Handbuchs ist uneingeschränkt zu empfehlen.
Rezensent: Dietmar Schmitz

Februar 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Peggy Leiverkus, Essensdarstellungen in Ovids Metamorphosen, Wuppertal: Polyphem-Verlag 2021 (Studia Montana) – 449 S. – ISBN 978-3-96954-003-9
Mit Peter Paul Rubens’ Jupiter und Merkur bei Philemon und Baucis als Covermotiv lädt Peggy Leiverkus ihre Leser*innen zu einer der bekanntesten Gastmahlszenen der römischen Literatur, gleichzeitig zu einer von vier ovidischen Essensschilderungen ein, die im Zentrum ihrer ebenso ausführlichen wie grundlegenden Monographie stehen. Dem, was sie ‚anrichtet‘ und ‚auftischt‘, liegt die von Stefan Freund betreute, von Christoph Schubert zweitbegutachtete und 2019 an der Bergischen Universität Wuppertal angenommene Dissertation der Verfasserin zugrunde. Besondere Erwähnung verdient die Wahl von Publikationshaus und -ort: Der noch junge Wuppertaler Polyphem-Verlag (https://www.polyphem-verlag.de/) gehört Peggy Leiverkus und ihrem Mann Patrick, der es übernommen hat (9) „[a]us dem Manuskript ein Buch zu machen, […] eine Kunst und bisweilen eine Plage.“ Das Resultat kann sich sehen lassen: Mit Liebe zum Detail, entwickeltem Fachwissen, philologischem Gespür und ohne je die großen Linien aus dem Blick zu verlieren, konzentriert sich die Autorin in vier ausgewogenen Kapiteln werkchronologisch auf aussagekräftige Passagen von sehr unterschiedlicher Länge aus den Metamorphosen. Sie setzt mit „Paradies oder Entbehrung? – Ovids goldenes Zeitalter (met. 1, 101-112)“ in der aurea aetas ein (unter Einbezug von Vergil, Horaz und Tibull), präsentiert „Römische pietas in drei Gängen – das Gastmahl bei Philemon und Baucis (met. 8, 626-724)“, wirft die im Gedächtnis bleibende Frage „Erdbeeren statt Menschenfleisch? – Polyphems Liebesgaben (met. 13, 812-837)“ auf und handelt schließlich „Über den Frevel des entarteten Bauches – die Rede des Pythagoras (met. 15, 75-478)“.
Dabei stellt Peggy Leiverkus überzeugend und nachvollziehbar Bezüge kompositorischer und inhaltlicher Natur zwischen den Episoden her und macht durchgehend die Rückbindung an mögliche Vorläufer und deren Einflüsse, aber auch Ovids ganz eigene Technik sichtbar: So liefert sie für das Goldene Zeitalter einen literaturgeschichtlichen Abriss von Hesiod bis Lukrez und eine kulturgeschichtliche Darstellung zu Weltaltermythen (Deszendenz, Aszendenz, Dialektik), verortet Philemon und Baucis motivgeschichtlich im Komplex der Theoxenie von der Genesis (mit hebräischem Text 166, nn. 21-22) über die griechische Literatur bis zu weiteren ovidischen Beispielen (aus den Fasti), präsentiert die verschiedenen ‚Polypheme‘ von Homer bis Nikochares zzgl. Schwerpunkt auf Theokrit und Vergil und gibt einen umfassenden Überblick über die Vegetarismusdebatte (mit Konzentration auf Empedokles und Theophrast). Nicht weniger als 23 Tabellen und (z.T. auch farblich) visuell hervorgebobene parallele Formulierungen ermöglichen den mühelosen Nachvollzug der Vielfalt des Gebotenen. Der weitgehend analoge Aufbau der vier Großkapitel und zahlreiche Rück- und Vorverweise unterstützen bei der raschen und zielgerichteten Orientierung in der umfangreichen Studie. Ein reichhaltiges und gut sortiertes Literaturverzeichnis und ein umfangreicher Index locorum (alphabetisch sortiert von Antiphanes bis Xenophanes) sind essentielle Hilfsmittel, die zugleich Einblick in den breiten Horizont der Verfasserin geben, aus dem – abgestimmt auf das Generalthema der Arbeit – eine systematische inhaltliche wie sprachliche, zuweilen auch textkritische Analyse in gut verdaulichen Portionen resultiert.
Als eine Art ‚Aperitif‘ ist dem ‚Hauptgang‘ – den vier Kapiteln zu den Metamorphosen – eine ‚Vorspeise‘ vorgeschaltet. Zu diesen ‚Appetizern‘ gehören neben dem erfrischenden Motto aus Herbert Grönemeyers Currywurst (11) „Gehse inne Stadt | Wat macht dich da satt | ’Ne Currywurst | Kommse vonne Schicht | Wat Schönret gibt et nich | Als wie Currywurst“ und konzisen „Vorbemerkungen“ (von Petron bis zum Epos) zunächst „Essensdarstellungen als Thema in der römischen Literatur“ (von Plautus bis Plinius). Es folgen ein ausführlicher „Forschungsüberblick“ (darunter „Soziologische und anthropologische Grundlagen“, „Forschungsansätze zum Essen und zur Ernährung in der Antike“, „Soziokulturelle Faktoren von Essen in der römischen Welt“ und „Essen als literarisches Motiv“) und eine Abrundung durch „Darstellungen von Essen in den Metamorphosen“, die Peggy Leiverkus wie ihre ganze Untersuchung als streng „[s]ystematische[n] Überblick“ anlegt.
Die Fülle des Materials bedingt es, dass manche Fußnote gleichsam Spezialstudien, wesentliche side steps zu den klugen Beobachtungen im Haupttext, enthält (z.B. 79-80, nn. 57-58 zu Empedokles und Hesiod). Desgleichen finden sich passim ausführliche Volltextzitate in den Fußnoten, die den Lesefluss der Interpretation unterbrechen würden, aber unerlässlich sind für ein möglichst vollständiges Erfassen der komplexen Materie. Somit besticht Peggy Leiverkus’ Arbeit neben neuen und stringent argumentierten Sichtweisen auf scheinbar bekannte (und vielleicht schon als ausinterpretiert angesehene) Episoden der Metamorphosen durch ein wohldosiertes Verhältnis von Kern- und Zusatzinformation – eine (Appetit)anregung zu Anschlussforschung. Wenn das so umgesetzt ist wie hier, dann dürfen Fußnoten durchaus beträchtliche Länge aufweisen.
Ovidische Spezifika sind kontinuierlich in kritischer Auseinandersetzung mit der (oft nahezu unüberschaubar gewordenen) Sekundärliteratur herausgearbeitet, zumal gerade im die Verfasserin besonders interessierenden Themenspektrum das weite Feld des Agrarwesens – Ackerbau ebenso wie Viehzucht –, aber auch die (allein schon terminologisch nicht immer unkomplizierten) Fachbereiche von Botanik und Zoologie in extenso zu berücksichtigen sind. Hiezu zieht sie gewinnbringend die entsprechende (landwirtschaftliche und enzyklopädische) Fachliteratur (v.a. Varros De re rustica, aber auch Plinius’ Naturalis historia) heran.
Nach der anregenden und abwechslungsreichen Lektüre von Peggy Leiverkus’ ‚Speisekarte‘ ist man Spezialist*in für Kornelkirschen, Erdbeerbäume (im Unterschied zu den [Wald]erdbeeren) und herbae (mit einer umfangreichen Begriffsgeschichte 126-128, n. 288). Man ist informiert über (überwiegend negativ eingestufte oder verhinderte) Tieropfer – Pythagoras macht sich mit Verve, Emotionalität und philosophischen Argumenten zum Anwalt der Mitgeschöpfe, die Gans von Philemon und Baucis darf weiterleben wie einst (zumindest zwischenzeitlich) der Widder des Molorchos in Kallimachos’ Aitia. Weiters wird man unterrichtet über die Lagerung von Schweinespeck und Dörrfleisch, über Eicheln (als [tierisches] Nahrungsmotiv) und über die Zubereitung von in Asche gegarten Eiern (mit einem doppelten Verweis auf Martial, der sich hiebei ausschließlich an Ovid anlehnt: 203, n. 199). Schließlich lernt man simple und gerade deswegen köstliche Gerichte kennen und erfährt so manches über anerzogenen Geschmack, der von der jeweiligen gesellschaftlichen Schichtenzugehörigkeit, aber auch vom finanziellen Vermögen abhängt – eine Vorform (oder Spielart) des Gegensatzes von Glutamat, Palmöl und künstlichen Aromen auf der einen und Bio-Nahrungsmitteln auf der anderen Seite. Man kann sich – um im Bild zu bleiben – durch die ganze Palette, sozusagen ab ovo usque ad mala, durchkosten oder (nur) einzelnes probieren: Das ‚Geschmackserlebnis‘ wird ein bleibendes sein.
Als Leser*in von Peggy Leiverkus erfährt man (oder fühlt sich darin bestätigt), dass Ovid vielfach multiperspektivisch, v.a. aber gegen den mainstream gelesen werden will: Sein Konzept der aurea aetas ist nicht (im naturwissenschaftlichen Sinn) eineindeutig; zivilisatorischer Fortschritt und Sehnsucht nach der ‚guten alten Zeit‘ (oder dem, was man darunter verstehen wollte) stehen gleichberechtigt nebeneinander; Ernährung hat durchaus mit (recht eindeutig römischer oder romanisierter) Moral(isierung) zu tun, wenngleich Ovids Essensdarstellungen aufgrund ironischer Brechung und damit einhergehender Distanzierung mehrdeutig bleiben (375): „Offenbar hat er sich bewusst dafür entschieden, sich auf dieses politisch aktuelle Feld zu begeben, aber auch dafür, nicht eindeutig Stellung zu beziehen.“ (Das hat u.a. den positiven Effekt, dass erhitzte wissenschaftliche Diskussionen darüber, ob Ovid im Gefolge des Pythagoras als eine Art Protovegetarier oder -veganer gesehen werden kann, vergnügt weitergehen dürfen und im Sinne des Meinungspluralismus und der akademischen Streitkultur die [philologische] Disziplin voranbringen.) Zudem erweist die Verfasserin Ovid als Meister der Gattungsmischung: Polyphems einseitig bleibende Liebe zu Galatea weist Schnittflächen zur (vergilischen) Bukolik auf, ist doch auch der einäugige Riese Hirte – im übrigen ein sehr römischer im Vergleich zu den griechischen Darstellungen. Ovids flirrende Doppelbödigkeit und ebenso psychologisierende wie genderspezifische Darstellung zeigt sich an der bestechenden Gegenüberstellung von Polyphems und Galateas abweichenden, v.a. aber völlig inkompatiblen Sichtweisen auf (gutes) Essen (290–291); daraus resultieren Missverständnisse, die wechselseitiges Verstehen und Verständnis verunmöglichen – und nicht zuletzt sind Bezugspunkte zur Satire vorhanden (372): „Das Gastmahl von Philemon und Baucis ist ein auf die Spitze getriebenes Musterbeispiel römischer frugalitas und pietas, Polyphem ist ein barbarischer Gourmet, Pythagoras ein wütender Moralapostel.“
Zutreffende Zuspitzungen wie diese – allesamt in den „Schlussbemerkungen“, sozusagen der ‚Nachspeise‘ – bleiben in Erinnerung und regen zum Nachdenken über die unzähligen Facetten an, die Peggy Leiverkus in großer Belesenheit und mit Feingefühl für den (Sub)text en détail interpretiert. „Essensdarstellungen in Ovids Metamorphosen“ werden ausschließlich über „Books on Demand, Norderstedt“ geliefert. Dem geschmackvollen Buch ist zu wünschen, dass dieses ‚Lieferservice‘ von möglichst vielen literarisch (und sozial- und kulturhistorisch interessierten) Gourmets in Anspruch genommen werden möge.
[cf. Wiener Studien – Rezensionen 134 (2021), 123-124 = https://doi.org/10.1553/wst_134]
Sonja Schreiner
Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein
Universität Wien
Universitätsring 1
A-1010 Wien
https://klassischephilologie.univie.ac.at/ueber-uns/mitarbeiterinnen/neulateinische-philologie/sonja-schreiner/Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Januar 2022
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Marion Giebel: Julian Apostata, Rede zu Ehren der Kaiserin Eusebia, zweisprachige Ausgabe, Speyer: Kartoffeldruck-Verlag 2021 (Opuscula 1) 100 S., 4, -- €[i]
Kai Brodersen: Symeon Seth, Fabelbuch, griechisch und deutsch, Speyer: Kartoffeldruck-Verlag 2021 (Opuscula 2) 172 S., 6,-- €
Gleich zwei Bücher, aber für einen Preis, für den man normalerweise bei weitem nicht einmal eines bekommt: Kai Brodersen hat sich mit dem von ihm begründeten und betriebenen Kartoffeldruck-Verlag (https://www.kai-brodersen.eu/kartoffeldruck-verlag/) vorgenommen, „zum reinen Selbstkostenpreis – in kleiner Auflage Bücher für Expertinnen und Experten in Altertumswissenschaft und Schule“ zu publizieren und damit Texten eine Leserschaft zu verschaffen, die von kommerziellen Zwängen unterworfenen (Groß)-Verlagen kaum angefasst würden (aber sie sind ganz regulär über den stationären und digitalen Buchhandel erhältlich).
Marion Giebel muss man hier nicht vorstellen (vgl. die Würdigung durch Friedrich Maier im 2019 im Forum Classicum: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fc/article/view/64756/57610), ihr Interesse an der Antike erstreckt sich von Homer bis zu Julian (mit dem von der christlichen Tradition verliehenen despektierlichen Beinamen Apostata), dem sie bereits 2002 eine biographische Darstellung gewidmet hatte. Nun befasst sie sich mit der Dankesrede Julians auf Eusebia (ca. 356/357 n.Chr), die als Gattin des Kaisers Constantius II ihn bei seiner politischen Karriere (noch war er allerdings nicht Kaiser) sehr unterstützte.
Das Büchlein weist all die Tugenden auf, die seit jeher die Publikationen Marion Giebels auszeichnen: eine konzise Einleitung, in der sie die Gattung des panegyricus vorstellt, sodann auf die Biographie Julians eingeht sowie speziell seine Beziehung zu Eusebia – all das mit Verweisen auf grundlegende und aktuelle Sekundärliteratur untermauert. Den Hauptteil (S. 15-81( bildet die griechisch-deutsche Rede selbst, wobei die Übersetzung in der von Marion Giebel gewohnten Qualität textnah und verständlich (auch ohne Beiziehung des Originals) ausgefallen ist und durch Anmerkungen unterstützt ist. Es schließt sich ein Anhang mit Parallelzeugnissen (Ammian, Libanios, Zosimos) an, bevor ein dreiseitiges Literaturverzeichnis das Buch beschließt.
Marion Giebels Ausgabe ermöglicht es, zu einem mehr als fairen Preis den Einstieg in eine Epoche zu finden, die viele Studierende und Lehrende der Altertumswissenschaften immer noch leichtfertig beiseitelassen, nicht ahnend, was sie dadurch verpassen. Und wer sich einmal darauf eingelassen hat, der wird womöglich mehr über die Spätantike und das sich anschließende Frühe Mittelalter wissen wollen – vielleicht folgen auf die 100 Seiten Marion Giebel die 1500 Seiten Mischa Meier. Das Julian-Buch also als Einstiegsdroge in die Spätantike – warum nicht?
Kai Brodersen, der Verleger und Reihenherausgeber, seinerseits hat – zu Ehren von Niklas Holzberg und dessen Arbeiten zur antiken Fabel – eine aus dem indisch-iranischen Raum stammende, arabisch überlieferte, im Mittelalter durch den Gelehrten Symeon Seth in byzantinisches Griechisch übersetzte Fabelsammlung aus den Tiefen der Wissensarchive geholt. Diese Wiederentdeckung bereichert das vor allem durch Äsop/Phaedrus geprägte Bild von der antiken Fabel und zeigt, dass es auch außerhalb der äsopische Tradition wichtige und mit Gewinn zu berücksichtigende Formen dieser Gattung gibt. Der Text im Umfang von je ca. achtzig Seiten (griechisch und deutsch, synoptisch angeordnet), verteilt auf zwei Teile, präsentiert einen in eine Rahmenerzählung eingebundenen Fürstenspiegel, in dem die Tiere durchaus nicht nur positiv gezeichnete Abbilder der Menschen sind: ein seiner selbst ungewisser Löwe als König, zwei Schakale als nicht uneigennützige Ratgeber, ein Stier, dem seine Kraft nichts nützt und der letztlich der Angst des Löwen zum Opfer fällt. In diese Haupthandlung eingelegt sind eine ganze Reihe von Exempeln, die vor allem von den Schakalen erzählt werden und die weitere, hierarchisch niedrigere Tiere (manchmal aber auch Menschen) als Handlungsträger haben. Die moralische Botschaft ist alles andere als eindeutig und gerade deshalb sehr reizvoll zu lesen: Es gibt nicht einfach Gut und Böse, Schwarz und Weiß, sondern viele Abschattierungen – und letztlich sind ethische Fragen doch wieder Machtfragen.
Mit der Reihe „Opuscula“ aus dem Kartoffeldruck-Verlag erhält das Publikum die Chance, sich für wenig Geld ein unbekanntes Terrain zu erschließen und wieder einmal festzustellen, welch reiche Schätze die Literatur der Antike und der antiken Tradition enthält – der Blick über den sich immer mehr verengenden Schulkanon hinaus wird vielfach belohnt. Kai Brodersen und Marion Giebel sei dafür herzliche gedankt.
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)


Dezember 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Michael von Albrecht, Sermones. Satiren zur Gegenwart. Lateinisch und Deutsch. Ars Didactica Bd. 8. Hrsg. von Hans-Joachim Glücklich. Propylaeum: Heidelberg 2021. EUR 36, 90 (ISBN 978-3-96929-026-2)
Michael von Albrecht gilt als einer der profiliertesten Klassischen Philologen im deutschsprachigen Raum. Bekannt ist seine Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius (in mehreren Auflagen erschienen, in zahlreiche Sprachen übersetzt). Allen Studentinnen und Studenten zur Lektüre empfohlen sind die beiden Bücher Meister der römischen Prosa. Von Cato bis Apuleius und Römische Poesie. Texte und Interpretationen (ebenfalls jeweils mehrere Auflagen) sowie einschlägige Publikationen zu Lukrez, Ovid, Seneca und Vergil. Häufig werden dabei auch Rezeptionsdokumente berücksichtigt. Michael von Albrecht ist auch als Übersetzer zahlreicher römischer Autoren aufgetreten. Weniger bekannt ist allerdings, dass er einer der bedeutendsten lebenden Dichter in lateinischer Sprache ist. Er hat Oden, Elegien und Epigramme verfasst, jetzt sind seine Satiren erschienen. Michael von Albrecht hat sich Horaz als Vorbild genommen, denn seine Sermones orientieren sich durch die Wahl der Zehnzahl, ihre Verknüpfung von „moralischer Ernsthaftigkeit und humaner Heiterkeit“ (Michael Lobe, 121) an dem großen augustäischen Dichter. Natürlich kennt er die Meister römischer Satiren, angefangen bei Ennius, der sich mehrerer Versmaße bediente, über Lucilius, der den Hexameter für seine Dichtungen bevorzugte, bis Persius und Iuvenal.
Die Themen der Sermones/Satiren, überwiegend als Dialoge gestaltet, sind vielfältig und aktuell. Die Titel dieser Texte belegen dies: Neugier, Lebensmittelvergeudung, Hunde, Zukunftsforschung, Umwelt, Corona, Waffen, Wahrheit, Nützlichkeit alter Leute sowie Reklame.
Das Besondere an dem angezeigten Buch ist einerseits, dass ein heutiger Dichter sich der lateinischen Sprache bedient. Dies tut er in souveräner Art und Weise, denn viele Begriffe müssen in dieser Sprache neu geschaffen werden, also durch Neologismen. Andererseits liefert er eine Übersetzung ins Deutsche gleich mit. Dass Michael von Albrecht diese Sprache ebenfalls meisterhaft beherrscht, geht aus jedem Vers hervor. Dazu verwendet er den sogenannten Blankvers, der für die deutsche Sprache angemessener ist als der Hexameter.
Im Vorwort betont Hans-Joachim Glücklich, der Herausgeber des Buches, dass Michael von Albrecht „die Rolle eines Zeitbeobachters und Satirikers“ einnimmt (7). Er hat die Fähigkeit, genau hinzusehen, in die Gesellschaft gewissermaßen hineinzuhorchen, seine Beobachtungen klug und witzig zu formulieren, ohne verletzend zu sein. Das gesamte Buch ist ein Plädoyer zum Erlernen der lateinischen Sprache, stellt aber auch einen Anreiz dar, sich mit antiken Themen zu befassen, die bis in die heutige Zeit aktuell sind. „Latein ist eine besonders schöne Sprache, man muss sie nur zum Klingen bringen. Dann versetzen die rhythmischen Verse und ihre Laute den Leser in Schwingungen“ (Hans-Joachim Glücklich, Vorwort 7).
Ein Textbeispiel mag belegen, wie souverän der Dichter mit den Themen, der lateinischen und der deutschen Sprache umgeht. Am Ende der dritten Satire, in der Michael von Albrecht auch auf Elemente der Fabel zurückgreift, hier in Anlehnung an die berühmte Fabel von der Stadtmaus und der Landmaus (Horaz), beschreibt er ein Hundeparadies. Zitiert werden die letzten Verse, 125-130:
Elysium hoc latrantum ubi sit, si forte requires,
vix animum induces: Clara reperitur in urbe
Afrorum, promunturiis ubi Spes Bona custos.
Africa, sunt populi innumeri tibi, mater, egentes,
Das catulo luxus, homini ieiunia linquis.
O Spesne ulla Bona est, in te quam ponere possim?
Fragst du, wo dieses Hundeparadies
denn sei? Du kommst nicht drauf: In Kapstadt ist’s,
ganz nah am Kap der Guten Hoffnung, Ach!
Gibst Hunden Luxus, Menschen lässt du darben.
Bleibt da ein Plätzchen noch für gute Hoffnung?
Hier stoßen Welten aufeinander, der Dichter wählt ausgerechnet den Gegensatz zwischen einem Hundeparadies und den Townships in Kapstadt. Für Michael Lobe, der die Einführung in die Satiren verfasst hat und eine Gesamtinterpretation liefert (119-127), handelt es sich um eine „dekadente Perversion“, die sich durch rhetorische Brillanz auszeichnet.
In der zweiten Satire, in dem die Lebensmittelvergeudung angeprangert wird, benutzt der Dichter für den Begriff Kaffee caffaea (Sat.II, V.11; es gibt in der neulateinischen Terminologie auch als Übersetzungsvorschläge: potio Arabica, coffeum, coffea). Kaffee gab es in der Antike bekanntlich nicht, und so müssen Neologismen verwendet werden.
In der fünften Satire wird der Umgang der Menschheit mit der Umwelt thematisiert. Dabei geht der Dichter auch auf das Faktum ein, dass viel Plastik in den Weltmeeren landet und der dortigen Tierwelt und damit letztendlich auch dem Menschen großen Schaden zufügt. Plastik ist ein Kunststoff, der in der Antike nicht hergestellt werden konnte. Michael von Albrecht wählt für Plastikmüll den lateinischen Ausdruck plastica materies (Sat. V, V. 41). Es gibt auch die Kombination materia plastica. Bei der Wahl der lateinischen Lexeme ist stets zu bedenken, dass sie in den Hexameter passen müssen.
Ein letztes Beispiel ist der zehnten Satire entnommen. Dort spricht der Dichter über Kühlschränke, die es natürlich in der Antike nicht gab; er benutzt die Kombination: armaria frigida (Sat. X, V. 98). Auch in diesem Fall gelingt es ihm meisterhaft, einen passenden Ausdruck zu finden (möglich wäre auch: armarium frigidarium, apparatus frigorificus oder einfach frigidarium). Aber, wie oben schon erwähnt, muss die Neuschöpfung am Hexameter orientiert sein.
Das Buch hat einen vielfältigen Blick auf verschiedene Leser; solche, die die lateinische Sprache beherrschen, solche, die dankbar sind für eine Übersetzung, und die Leserinnen und Leser, die sich gerne bei der Lektüre anleiten lassen. Dazu dienen einerseits die bereits erwähnte Gesamtinterpretation von Michael Lobe, andererseits die Methodischen Vorschläge zur genussreichen Lektüre der Sermones im Lateinunterricht, die der Herausgeber beisteuert (129-142). Zusätzlich bieten der Dichter und Michael Lobe Hilfen an, um einzelne Textstellen besser einordnen zu können: Adnotationes. Anmerkungen und Erläuterungen zu den Sermones (109-117). Das Verzeichnis der Eigennamen (143-156) stammt vom Dichter höchstpersönlich und belegt ein weiteres Mal seine große Belesenheit und die außergewöhnlichen Kenntnisse der griechisch-römischen Welt.
Michael Lobe sieht in dem Satirenbuch einerseits „ein kritisch-humorvolles Panoptikum unserer Gegenwart, ihrer Probleme, Versäumnisse und Dummheiten“ (121), glaubt andererseits, dass es „durchzogen ist von unaufdringlicher philosophischer Altersweisheit – kulminierend in der achten Satire mit ihrer zentralen Frage nach dem Wesen der Wahrheit“ (121).
Wir können dem Dichter Michael von Albrecht großen Dank aussprechen, dass er uns mit diesen Texten reich beschenkt hat. Sie enthalten viel Anregendes, Kritisches, Nachdenkliches, Witziges und zeichnen sich durch große Virtuosität aus. Dass unser Dichter auch ein ausgezeichneter Musiker und ausgewiesener Kenner der antiken Musik ist soll nicht unerwähnt bleiben. All seine besonderen Fähigkeiten tragen dazu bei, dass er auf ein imposantes Lebenswerk zurückblicken kann.
Rezension: Dietmar Schmitz

November 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Markus Janka: Vergils Aeneis. Dichter – Werk – Wirkung. München: Beck 2021 (Beck Wissen) 128 S. mit zwei Schaubildern, 9,95 €.
Wie soll man Vergil lehren? Wie findet man zwei Jahrtausende, nachdem er von Q. Caecilius Epirota erstmals auf einen Lehrplan gesetzt wurde, einen adäquaten Zugang, der den Autor und seinen Text ernst nimmt und verständlich macht. Markus Jankas Beitrag zur Aeneis (und eigentlich zum ganzen Vergil) in der Reihe Beck Wissen (die die Autoren in ein strenges Seitenkorsett einpasst) findet darauf mitunter überraschende und zum weiteren Nachdenken im besten Wortsinne provozierende Antworten.
Diese Feststellung gilt vor allem für die ersten Kapitel. Janka setzt nicht – wie die bekannten Einführungen zu Vergil von Giebel bis Holzberg – biographisch ein, sondern mit einer detaillierten, dem Gehalt der einzelnen Wörter nachgehenden Interpretation des Proömiums (Aen. 1,1-11), wodurch Vergil als Erneuerer Homers (nicht sein Nachahmer!) deutlich wird: Vergil ist ein Hyperhomer, das lateinische Epos findet auf diese Weise einen neuen Zugang zu alten Themen. Das wird im folgenden Kapitel noch ausgebaut, wenn die Aeneis mit den Kategorien der hellenistischen Epik, namentlich der Argonautika des Apollonios Rhodios, begriffen wird und vor allem als Vorwegnahme des carmen perpetuum et deductum (Ovids Selbstcharakterisierung im Metamorphosen-Promömium) erscheint: Die Aeneis ist ein radikal innovatives Werk – und so füge ich hinzu: Es war gerade Vergils Erfolg und seine Kanonisierung in Schule, Bildung und Kultur, der diese radikale Innovation rezeptionsgeschichtlich aus dem Bewusstsein rücken ließ. Es lohnt sich aber nicht nur für die schulische Beschäftigung, diese Dimension wiederzuentdecken.
Zwei weitere grundsätzliche Kapitel schließen sich an: In „Ille ego qui …“ spürt Janka ausgehend vom sog. Vorproömium der Aeneis dem Zusammenhalt von Vergils kanonischen Dichtungen nach und schafft so eine thematisch fokussierte Synopse von Eklogen, Georgica und Aeneis. In „Hic vir … Augustus Caesar“ liest Janka die Aeneis als ein zwar den Prinzipat des Augustus bejahendes, aber nicht panegyrisches Epos, dessen Protagonist Aeneas nicht einfach eine auf Identität abzielende Rückprojektion des historischen Augustus ist.
Der längere zweite Teil des libellus geht die einzelnen Aeneisbücher in einem close reading durch. Die einzelnen Bücher werden durch die jeweilige Zentralgestalt schon in den Überschriften charakterisiert, von Aeneas über Achaemenides und Dido bis hin zu Pallas, Camilla und Turnus: Der Tod des Turnus wird in all seiner Verstörung deutlich gemacht, eine versöhnliche Auflösung erfolgt weder bei Vergil noch bei seinem Interpreten.
Über die Rezeption Vergils von dessen Lebzeiten bis ins 21. Jahrhundert sind ganz Bibliotheken geschrieben und wären noch viele Supplemente zu schreiben. Janka beschränkt sich auf den zur Verfügung stehenden weniger als zwei Seiten darauf, einige Spuren in das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert zu legen – eine Erinnerung für den Leser, dass mit dem Ende der Aeneis und Vergils Tod eben bei weitem nicht alles zu Ende ist.
Der durch die Reihe „Beck Wissen“ vorgegebene Umfang erlaubt keine ausführliche Bibliographie. Sie ist auf wenige, essentielle Titel beschränkt, weiteres ist dann ins Internet ausgelagert und kann dort auch prinzipiell immer wieder erweitert werden (https://www.chbeck.de/media/4300/inh_bw2884jankavergilsaeneis_978-3-406-72688-0_1a_literaturhinweise.pdf) – ich vermisse dort eigentlich nur die (in der Forschung notorisch unterbewertete) monumentale Enciclopedia Virgiliana (1984-1990) sowie von Richard Thomas und Jan Ziolkowski ihre fast ebenso monumentale Zusammenstellung „The Virgilian Tradition. The first fifteen hundred years“ (2008). Und vielleicht lässt sich als weiteres Download-Angebot auch noch ein Glossar realisieren, das vor allem der Verwendung durch Schüler in der gymnasialen Oberstufe zugute kommen könnte. Wie sehr der Raum ausgenützt wird, zeigt sich daran, dass sogar die Umschlaginnenseiten verwendet werden, um mit zwei Schemata (zum Aufbau der Aeneis und zur tragischen Struktur der Dido-Erzählung) auch optisch aufbereitetes Material zu präsentieren.
Bleibt mir nur als Fazit: Ich bin beeindruckt, wie der Verfasser ein so in jeder Hinsicht umfangreiches Werk konzentriert in den Griff bekommen hat, es instruktiv aufbereitet und auch dem, der schon oft sich am Vergil versucht hat, neue Anregungen bietet. Und das für weniger als 10 Euro!
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
Oktober 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Jan Weidauer: Männlichkeit verhandeln: Von Lüstlingen, Kriegern und wahren Römern (1./2. Jh. n. Chr.). Heidelberg: Propylaeum, 2021. Mainzer Althistorische Studien (MAS), Bd. 9. https://doi.org/10.11588/propylaeum.813
Was bedeutet es, ein ,echter Mann‘ zu sein? Diese Frage will Jan Weidauer für die Elite des kaiserzeitlichen Rom beantworten. Seine Studie „Männlichkeit verhandeln“, eine geringfügig überarbeitete Fassung seiner in der Alten Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingereichten Dissertationsschrift, bietet ein Beispiel für ein zunehmendes Forschungsinteresse an Männern und Männlichkeit in der griechisch-römischen Antike. Die im Open-Access-Format publizierte Studie ist unter dem oben genannten Link dauerhaft frei verfügbar.
Im lesenswerten und klar strukturierten Einleitungskapitel führt Weidauer an Fragestellungen und Konzepte der Geschlechter- und Männlichkeitsforschung heran. Ausgehend von der Vorstellung von Geschlecht als kulturellem Konstrukt setzt er sich u.a. mit den Konzepten der Performativität von Geschlecht (Butler), der hegemonialen Männlichkeit (Connell) und des Habitus (Bourdieu) auseinander und skizziert auf dieser Grundlage seinen eigenen theoretisch-methodischen Zugriff, der sich besonders auf Bourdieu und Butler stützt. Ein nach Bereichen wie Sexualität, Rhetorik, Semantik usw. gegliederter Forschungsüberblick zeigt, inwiefern bereits eine „altertumswissenschaftliche Männlichkeitsforschung“ existiert.
Im diskursanalytischen Hauptteil untersucht Weidauer zuerst die Verspottung in sexueller Hinsicht devianter Männer im „satirischen Diskurs“, den er in Martials Epigrammen und Juvenals Satiren findet. Ergänzt wird diese Perspektive durch einen „ethnischen Diskurs“, wie er sich für Weidauer in den Ausführungen über Germanen bei Tacitus und in Bezugnahmen auf die griechische Athletik im Rhetorikhandbuch Quintilians manifestiert. Vor der Folie hypermaskuliner germanischer Krieger, hyperzivilisierter Graeculi oder dem Spott über effeminierte Männer lässt sich für das kaiserzeitliche Rom eine moralische Konzeption von Männlichkeit erkennen, wobei Selbstbeherrschung (continentia sui) und Leidensfähigkeit (virilis patientia) als Säulen der virtus die Grundlage männlicher Autorität darstellen. Durch entsprechendes Handeln in verschiedenen Lebensbereichen muss sich ein Römer in diesem Sinne als ,echter Mann‘ erweisen und seine Männlichkeit performativ aktualisieren.
Für die Auseinandersetzung mit dem seit Längerem im Zentrum des medialen Interesses stehenden Themas „Männlichkeit“ im altsprachlichen Unterricht bietet Weidauers anregende Studie zahlreiche Impulse.
(Rezension: Petra Schierl)

September 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Sappho, Lieder. Griechisch/Deutsch. Hrsg. und übersetzt sowie mit Anmerkungen und Nachwort versehen von Anton Bierl. Reclam Verlag: Stuttgart 2021. 448 S. EUR 14,80 (ISBN 978-3-15-014084-0)
Anton Bierl, Professor für Gräzistik an der Universität Basel, hat eine neue Ausgabe der Werke der griechischen Dichterin Sappho vorgelegt. Sie nannte sich selbst Ψάπφω/Psappho und wurde von Platon als zehnte Muse bezeichnet. Sappho wird nach Aussagen des Forschers für eine Ausnahmeerscheinung gehalten und galt als einzigartige selbständige Frau in einer Welt, in der Männer dominierten. Die Themen ihrer Lieder, die fast nur fragmentarisch überliefert sind, sind Eros und die weibliche homoerotische Liebe. Vieles Mysteriöse ist mit ihrer Person verbunden. Bierl bietet neben den griechischen Texten eine eigene Übersetzung ins Deutsche. Nur ein kleiner Bruchteil ihrer Texte ist tradiert, aber im Laufe der Zeit wurden immer wieder Textteile als Zitate bei anderen Autoren gefunden, zuletzt im zwanzigsten Jahrhundert, 2004 von zwei Kölner Klassischen Philologen (Michael Gronewald und Robert Daniel) und 2014 von dem amerikanischen Papyrologen Dirk Obbink. Bierl bietet den Lesern zweckmäßige Hilfen, einmal durch die zahlreichen Anmerkungen zu jedem Text, zum anderen in seinem sehr gehaltvollen Nachwort. Darin finden sich Hinweise auf die familiäre Herkunft Sapphos und auf die damalige Gesellschaft auf Lesbos (7./6. Jahrhundert v. Chr.), Ausführungen über ihre Auffassung von Lyrik, über Mythos, Rituale und Poesie und über die sogenannte Sapphische Frage: weibliche Homoerotik und der Mädchenkreis. Bierl bietet Einblicke in die Überlieferung und Anordnung des Textes und geht ausführlich auf die Rezeption ein. Er erläutert seine Vorstellung von Translation. Wer sich mit frühgriechischer Lyrik und speziell mit dem Werk Sapphos befassen will, wird viel Freude an diesem Buch haben, das auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand ist.
(Rezension: Dietmar Schmitz)

August 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Dennis Pausch: Virtuose Niedertracht. Die Kunst der Beleidigung in der Antike. München: Beck 2021. 223 S. € 22,--
Calumniare audacter, semper aliquid haeret – das ist leider kein antikes, sondern neuzeitliches Latein (und stammt von Francis Bacon), aber es trifft die Kunst der Verleumdung, die ars invectiva, von der Dennis Pausch (TU Dresden) zu berichten weiß, gewissermaßen wie der Hammer nicht den Nagel, sondern den Daumen – es tut weh, zumindest denen tut es weh, die die Antike immer noch auf das Gute, Wahre und Schöne beschränken.
Pausch gibt auf etwas mehr als 150 Textseiten einen Überblick über die Beleidigungskunst von Cato und der römischen Komödie bis zu Fronto und der Historia Augusta, wobei die Schwerpunkte auf Cicero und Catull, der Satire und Martials Epigrammen liegen, außerdem natürlich auf den Graffiti aus Pompei. Als Themenkomplexe identifiziert Pausch die Angriffe auf (republikanische) Politiker „von unten“, den Streit von Politikern oder Schriftstellern untereinander, die Polemik gegen Herkunft, (niedrige) Berufe oder abweichendes, v.a. effeminiertes Verhalten – man hätte auch noch den gnadenlosen Umgang mit körperlicher Behinderung hinzufügen können, aber das wäre vielleicht eine zu arge Provokation des modernen Lesepublikums gewesen.
Das Buch ist zum einen eine verlässliche, kurz gefasste Einführung in die Kunst der Beleidigung in Rom, zum anderen gewinnt es seinen aktuellen Bezugsrahmen durch die immer wieder eingestreuten Schlaglichter auf heutige Erscheinungsformen der Polemik und Beleidigung – ob das nun der battle rap, der Hashtag #notmyconsul oder die Drohung into your face Piso ist. Das ist nicht einfach mit der Wurst nach der Speckseite geworfen, sondern eine Ermutigung, die antiken Texte mit der Brille heutiger Erfahrung zu lesen. Denn die möglichen Aktualisierungen sind natürlich nicht auf die Stichworte Pauschs beschränkt, sondern lassen sich immer wieder neu generieren und auch ad hoc in die universitäre oder schulische Unterrichtspraxis transponieren. Das Buch in jeder Hinsicht anregend – und wenn wirklich ein Schüler oder eine Studentin dann auf Latein beleidigt, dann beleidigt er oder sie wenigstens gebildet.
(Rezension: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
Juli 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Dietmar Schmitz, Kleine Schriften. Antike – Spätantike – Neuzeit – Fachdidaktik. Analysen griechischer und römischer Texte, Aspekte ihrer Rezeption und Transformation, Übersetzungen lateinischer Texte und Gedanken zur didaktischen Umsetzung. Reihe Studien zur klassischen Philologie Bd. 181. Berlin 2021. 1011 S., 129,95 EURO (ISBN 978-3-631-83623-1)
Der lebendige Austausch zwischen Fachwissenschaft und Schule gehört sicher zu den Eigenheiten und Vorzügen der Alten Sprachen. Einer, der diesen Brückenschlag in besonderer Weise verkörpert, ist gewiss Dietmar Schmitz, als Forscher zur klassischen Antike, zur Spätantike, zum Humanismus und zur Fachdidaktik (insbesondere, aber nicht nur, zu den Unterrichtswerken), stets unter Einbeziehung auch seiner romanistischen Bildung, genauso hervorgetreten wie als Lehrer und Rezensent. Nun liegt eine große Sammlung seiner kleinen Schriften im Umfang von über 1000 Seiten vor. Darin enthalten sind bekannte Beiträge wie etwa zu den Zeugen in Ciceros Verres-Reden (19-29), zu den römischen Wertbegriffen bei Christen und Nichtchristen in der Spätantike (343-369) zum ‚Wandel in der Konzeption lateinischer Unterrichtswerke‘ (685-747) usw. Ergänzend komme anregende Originalbeiträge hinzu, etwa zur Todesproblematik bei Seneca (31-57), Einführendes zu Sueton (59-62) und Muretus (479-491) sowie zu mittelalterlichen Texten im Lateinunterricht (799-831). Einen bemerkenswerten Abschnitt stellen auch die Beiträge zur humanistischen Tradition in der Romania dar (493-523, teilweise spanisch oder französisch), ihr fachdidaktisches Komplement finden sie in Überlegungen über ‚Latein und Griechisch als Basisfächer für das Erlernen der spanischen Sprache‘ (793-798). Alle vier bereits im Untertitel genannten Hauptkapitel enden mit einer Zusammenstellung thematisch einschlägiger Rezensionen – die längste umfasst mehr als 100 Seiten. Willkommen ergänzt wird dieses vielseitig anregende Werk durch Namens- und Begriffsregister.
(Rezension: Stefan Freund)

Juni 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Bernhard Zimmermann (Hrsg.), 29. Salemer Sommerakademie. Frauen und Frauenbild in der Antike. Reihe Paradeigmata Bd. 64. Baden-Baden 2021. 178 S., 34 EURO (ISBN 978-3-96821-777-2)
Die Sommerakademie in Salem bietet regelmäßig Fortbildungen an; die letzte Tagung stellte das Thema: „Frauen und Frauenbild in der Antike“ in den Vordergrund. B. Zimmermann hat den Band mit großer Sorgfalt herausgegeben. Zunächst werden Heldinnen der Odyssee vorgestellt; dann wird herausgearbeitet, auf welche Weise römische Dichter wie Catull, Vergil und Ovid das Bild einiger Heldinnen wie Kalypso, Nausikaa und Kirke verändert haben (Th. Baier). Verschiedene Interpretationsmöglichkeiten der Bildteppiche in Ovids Metamorphosen (6,70-128) werden ebenso feinfühlig präsentiert (M. Lobe) wie das Frauenbild der antichristlichen Polemiker der Spätantike (Chr. Riedweg). Archäologische Aspekte im Zusammenhang mit mythischen Heldinnen und Göttinnen erörtert C. Reinhardt. Wie Kleopatras Selbstmord in Filmen und literarischen Verarbeitungen konzipiert wird steht im Fokus eines Beitrags von A. Bettenworth. Schließlich widmet sich C. Walde dem Thema: Schicksal der Frauen im Bürgerkrieg. Textgrundlage ist das Bellum civile von Lucan. Es werden in allen Beiträgen zahlreiche Facetten der jeweiligen Sujets feinsinnig und kenntnisreich erörtert, und dies in einem gut lesbaren Duktus.
(Rezension: Dietmar Schmitz)

Mai 2021
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Friedrich Maier, Sophia. Morgenröte der Vernunft. Die Karriere der Philosophie. Ovid-Verlag Bad Driburg 2021. 168 S., 10 EURO (ISBN 978-3-938952-41-2)
Friedrich Maier, langjähriger Vorsitzender und inzwischen Ehrenvorsitzender des Deutschen Altphilologenverbandes, hat den fünften Band seines humanistischen Essayquintetts publiziert. Im Vordergrund steht der Wertbegriff sophia, der eng mit dem Philosophiebegriff im Zusammenhang steht. Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, über Wertbegriffe und Wertvorstellungen nachzudenken und sie in den aktuellen Diskurs einzubringen. Der Autor stellt in dreizehn Essays die verschiedenen Facetten des Begriffs sophia vor, dabei beginnt er mit einem Zitat aus der Ilias des Homer, einem der bedeutendsten literarischen Werke der europäischen Geistesgeschichte. Chronologisch durchforstet Maier die wichtigsten antiken Texte im Hinblick auf den Begriff sophia, grenzt ihn ab zur sapientia und stellt die verschiedenen Bedeutungen des deutschen Komplementärbegriffs Weisheit vor. Er geht aber weit über die antiken Gedanken zur Weisheit hinaus und prüft punktuell die Relevanz des seiner Meinung wichtigsten Wertbegriffs bis in die heutige Zeit. Unterstützt werden die Gedanken des Autors durch visuelle Eindrücke, Werke der europäischen Malerei der Neuzeit, aber auch Mosaike aus der Antike, sowie es bei Publikationen im Ovid-Verlag üblich ist. In den klar gegliederten Beiträgen verzichtet Maier auf Fußnoten, der interessierte Leser findet im Literaturverzeichnis wichtige Publikationen zur Thematik.

Alte Sprachen in Rheinland-Pfalz: Film zum altsprachlichen Bildungsangebot
- Details
Das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz möchte die Öffentlichkeitsarbeit für Latein und Griechisch durch die Bereitstellung eines Films unterstützen. Der kindgerecht gestaltete Animationsfilm möchte nicht nur informativ das Potenzial des altsprachlichen Unterrichts entfalten, sondern auch Lust machen auf das Unbekannte und dazu motivieren, sich auf das Abenteuer Latein und Griechisch einzulassen.
Der Film wird Ihnen für die Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Schule zur Verfügung gestellt und kann vielfältig im Werben für den altsprachlichen Bildungsgang eingesetzt werden, in Präsentationen an Informationsveranstaltungen ebenso wie auf der Website Ihrer Schule.
Sie finden den Film unter folgendem Link: www.altesprachen.rlp.de.
oder hier auf Youtube:
Neu: Der DAV-Newsletter
- Details

Der DAV freut sich, Ihnen heute ein neues Informationsangebot vorzustellen: Den ersten DAV-Newsletter auf Bundesebene.
Wir versprechen uns von diesem etwa alle zwei Monate erscheinenden Rundschreiben eine bessere kommunikative Vernetzung nicht nur mit den DAV-Mitgliedern, sondern auch mit weiteren Interessierten aus der Kultur- und Sprachenszene sowie aus den Kultusverwaltungen und der Politik.
Über den Newsletter bekommen Sie regelmäßig und in engerem Turnus als über die traditionellen Verbandspublikationen Wissenswertes aus Fachwelt und Bildungspolitik, soweit sie uns betrifft, im nationalen und internationalen Rahmen vorgestellt. Wir sind um Aktualität bemüht.
Falls Sie selbst eine Nachricht oder eine Ankündigung weitergeben möchten, können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Für den Newsletter können Sie sich » hier registrieren.
Sie können die erste Ausgabe auch hier probelesen:
[ Vorschau: Ausgabe 1 (November 2016) ]
Pegasus-Onlinezeitschrift
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
 Die Pegasus-Onlinezeitschrift
ist ein wissenschaftliches Periodikum zur Didaktik und Methodik der
Fächer Latein und Griechisch, wird vom Deutschen Altphilologenverband
herausgegeben und ist erstmals im Dezember 2000 erschienen.
Die Pegasus-Onlinezeitschrift
ist ein wissenschaftliches Periodikum zur Didaktik und Methodik der
Fächer Latein und Griechisch, wird vom Deutschen Altphilologenverband
herausgegeben und ist erstmals im Dezember 2000 erschienen.Die Pegasus-Onlinezeitschrift schafft eine Plattform zur ausführlichen und fundierten bildungstheoretischen Diskussion und didaktisch-methodischen Reflexion über die Fächer Latein und Griechisch:
Gymnasium
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
 im Internet: GYMNASIUM
im Internet: GYMNASIUM
Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung.
(Sechs Hefte jährlich.)
Das Abonnement können Sie bestellen bei:
Universitätsverlag Winter, Postfach 10 61 40, 69051 Heidelberg
Forum Classicum
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Zeitschrift für die Fächer Latein und Griechisch an Schulen und Universitäten.
(Vier Hefte jährlich)
DAV-Mitglieder erhalten diese Zeitschrift kostenlos.
Nicht-Mitglieder können die Zeitschrift bestellen bei:
C.C. Buchner Verlag, Postfach 1269, 96003 Bamberg

