Neuerscheinung des Monats
Juni 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
K.- W. Weeber, Schöner schimpfen auf Latein. Reclam: Ditzingen 2022. EUR 8,- (ISBN: 978-3-15-014308-7).
Wie in früheren Epochen so wird auch in unserer Zeit in vielen Bereichen beleidigt, geschimpft, polemisiert und denunziert. Vor allem in den Medien und sozialen Netzwerken gibt es ständig Verbalattacken gegen Mitmenschen, oft anonym, aber auch ganz offen. Dies war in der Antike nicht viel anders. Daher hat sich der bekannte Altertumswissenschaftler Karl-Wilhelm Weeber mit dieser Thematik näher auseinandergesetzt.
Bereits in der Einleitung (7-8) seines Bändchens geht er auf die Bereiche ein, in denen die Römer Schimpfwörter benutzten: auf Graffiti, auf Latrinenwänden, aber auch in der sogenannten hohen Literatur. Weeber informiert darüber, dass Schimpfwörter im schulischen Unterricht des Faches Latein so gut wie nicht vorkommen. Auf der anderen Seite stellen solche Begriffe einen selbstverständlichen Teil des römischen Alltagslebens „und römischer Zivilisation dar“ (8). Weeber will einer breiteren Öffentlichkeit die lateinischen Schimpfwörter vorstellen. Natürlich hat die Fachwissenschaft auch diesen Bereich der lateinischen Sprache ausgiebig untersucht und tut dies aktuell immer noch. So hat sich ein Sonderforschungsbereich (1285) an der Universität Dresden dieser Thematik (Invektivität) verschrieben. Weeber verweist auf einige wenige Publikationen zum Thema (I. Opelt, Die lateinischen Schimpfwörter und verwandte sprachliche Erscheinungen. Heidelberg 1965; Ph. Dubreuil, Le marché aux injures. Paris 2013; der Reclam-Verlag bietet als Download weitere Literaturhinweise). Für diejenigen Leserinnen und Leser, die sich intensiver mit dem anstehenden Sujet befassen wollen, sei auf weitere Veröffentlichungen hingewiesen (M. Wissemann, Schimpfwörter, https://www.telemachos.hu-berlin.de/latlex/s7.html; S. Koster, Die Invektive in der griechischen und römischen Literatur. Meisenheim am Glan 1980; G. Fink, Schimpf und Schande. Eine vergnügliche Schimpfwortkunde des Lateinischen. Zürich/München 1990). In der Linguistik gibt es in der Regel nur Umschreibungen des Begriffs Schimpfwort, aber noch keine allgemein anerkannte Definition. Ob außer Substantiven und Adjektiven auch Redewendungen als Schimpfworte anerkannt werden, ist umstritten. Reinhold Aman hat folgende Definition vorgeschlagen: „Jedes Wort, das aggressiv verwendet wird, ist ein Schimpfwort“ (Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch. Süddeutscher Verlag München 1972, 165). Weeber verweist auf die Listen im Buch von I. Opelt, „die sich je nach Kontext und Sprechintention als Schimpfwörter eigneten“ (S. 9f.). I. Opelt hat in ihrer Freiburg Habilitationsschrift folgende Definition vorgelegt, die sie auch in ihren zahlreichen weiteren Publikationen zum Thema zugrunde legt: „Das Schimpfwort ist die nominale prädikativische Feindanrede oder Feindbezeichnung normbezogen-negativen Inhalts, die in beleidigender Absicht geschieht und in der sich zugleich die Erregung des Schimpfenden löst“ (I. Opelt, a. a O., 18). Da Weeber sein Buch zur vergnüglichen Lektüre konzipiert hat und den Leserinnen und Lesern Spaß vermitteln will, in Anlehnung an einen Gedanken von Apuleius („intende, lector, laetaberis /Leser, pass auf, du wirst deinen Spaß haben!“ (Apuleius, Metamorphoses I 1,6) (Weeber, S. 8), mögen diese Gedanken zur Problematik einer Definition des Begriffs „Schimpfwort“ an dieser Stelle genügen.
Weeber versucht auf knappem Raum (128 S.) in 10 Kapiteln den Leserinnen und Lesern die wichtigsten Informationen mit zahlreichen Sprachbeispielen zu vermitteln. Den Titel des ersten Kapitels hat Weeber folgendermaßen formuliert: Vollpfosten, Schnarchliesen, aufgewärmte alte Knacker. Eine lateinische Schimpfwortkunde (9-24). Wie verbreitet der Gebrauch von Schimpfwörtern gewesen sein muss beweist die Tatsache, dass die Römer zahlreiche Begriffe für dieses sprachliche Phänomen verwendeten. Weeber nennt solche Lexeme auf den Seiten 10 und 11. Maledictum (Schmähung, Beleidigung) wurde häufig benutzt, convicium ist ein „Schimpfwort, das sich mit viel Geschrei und Zank verbindet“ (10), während man sich der Wörter probrum und opprobrium (beschimpfender Vorwurf) bediente, um auf einen konkreten Sachverhalt anzuspielen. Weeber führt des weiteren Begriffe wie contumelia (Schmach) und iniuria (Unrecht) an. Wenn jemand gleich mehrere Schimpfwörter gebrauchte, um über sein Gegenüber herzufallen, sprachen die Römer von impetus (Schimpfwort-Kanonade, 10). Falls die Positivform eines Adjektivs dem Redner zu gering erschien, verwendete er gerne auch den Superlativ/Elativ. Wenn spurcus (unflätig) nicht genügte, konnte spurcissimus (extrem schweinisch) die Attacke verstärken (10).
Eine sehr reiche Quelle für Schimpfwörter bieten die Komödien des Plautus, vor allem der Pseudolus und der Persa. Ein Auszug aus der zuerst genannten Komödie zeigt die große Vielfalt von Schimpfwörtern, die Plautus in den Gesprächen einbaut (11-13). Folgende drei Beispiele mögen dies belegen, jeweils im Vokativ: Sceleste (Verbrecher), legerupa (Gesetzesbrecher), fugitive (Drückeberger). Im weiteren Verlauf des Kapitels nennt und erläutert Weeber einige Bereiche, aus denen die Römer gerne ihre Schimpfwörter geschöpft haben. So bietet das Tierreich eine reiche Quelle. Beispielsweise verwendeten die Römer häufig das Schimpfwort canis (Hund/Hündin). Weeber belässt es nicht bei der Nennung des Begriffs, sondern liefert einige interessante Erläuterungen, damit der heutige Leser/die heutige Leserin das Schimpfwort besser einordnen kann. So verfährt Weeber auch in anderen Fällen. Weitere Bereiche, die eine Fundgrube für Schimpfwörter darstellen, sind etwa die Natur, der Mensch (vetula (alte Schachtel) oder decrepitus (abgeklapperter Tattergreis)), sexuelle ‚Perversionen‘ (impudicus (Lustmolch)), charakterliche Mängel (petulans (unverschämt)), das übermäßige Streben nach Reichtum und Besitz (avarus (Geizkragen) und vieles mehr.
Im zweiten Kapitel wendet sich Weeber dem politischen Bereich zu. Das Kapitel lautet: Du Verbrecher, Du Seuche, Du Schandfleck. Hatespeech in der Politik (25-49). Römische Redner nahmen in ihren Ansprachen kein Blatt vor den Mund und gingen zuweilen rücksichtslos gegen ihre Kontrahenten vor, ob vor Gericht, im Senat oder in der Volksversammlung. Weeber liefert einige Textbeispiele aus den Reden Ciceros und aus dem Werk des Sallust. Neben Marcus Antonius war Lucius Calpurnius Piso einer der ärgsten Widersacher des römischen Redners aus Arpinum, da er Ciceros Rückkehr aus der Verbannung hintertreiben wollte. In seiner gesamten Rede polemisiert Cicero gegen seinen Gegner, ja Feind: Quid enim illo inertius, quid sordidius, quid nequius, quid enervatius, quid stultius, quid abstrusius? – „Was gibt es für ein Subjekt, das fauler, dreckiger, nichtswürdiger, schlapper, dümmer und hinterhältiger sein könnte als dieser Kerl!“ (frg. 7, S. 29/30).
Ein weiteres interessantes Sprachfeld bieten die römischen Namen; Weeber erläutert die Bedeutung zahlreicher römischer Namen im dritten Kapitel: Dumme, Dicke, Schlappohren und Plattfüsse. Namen, die bezeichnen und zeichnen (50-58). Der berühmte Dichter der augusteischen Zeit Horaz hieß Quintus Horatius Flaccus, wobei das Cognomen ‚Schlappohr‘ bedeutet. In einem berühmten Prozess des Jahres 70 v. Chr. hielt Cicero Reden gegen den Statthalter auf Sizilien, Verres, das ‚Warzenschwein‘. Aufgrund seiner rhetorischen Glanzleistung in diesem Verfahren avancierte Cicero zum ersten Redner Roms. Der Redner, der erfolgreich sein wollte, musste bei der Wahl der Schimpfwörter versuchen, sein Publikum genau einzuschätzen, damit er nicht das Gegenteil von dem bewirkte, was er erreichen wollte. Weeber verweist auf eine wichtige Schrift Ciceros, nämlich de oratore, in der entscheidende Aspekte genannt werden, die berücksichtigt werden sollten (de orat. II 239). In den folgenden Kapiteln offeriert Weeber Hinweise auf Schimpfwörter, die auf Fluchtafeln zu finden sind (Kapitel 4: Macht ihn fertig, Dämonen! Aus der Welt der Fluchtafeln, 59-75), und auf solche, die diejenigen trafen, die es wagten, sich an einem öffentlichen Raum zu erleichtern (Kapitel 5: Cacator, cave malum. Warnung vor Wildpinkeln und Schlimmeres, 76-82). Das sechste Kapitel trägt den Titel: Der listige Chilon lehrte, leise zu furzen. Philosophische Latrinenparolen (83-86). Im siebten Kapitel stehen Schleudergeschosse im Vordergrund: Eicheln, die verletzen sollen. Schleudergeschosse als psychologische Kriegsführung (87-93). Die glandes, eichelförmige Bleigeschosse von 50 bis 70 Gramm, sollten die Gegner verunsichern und demoralisieren (87). Sie konnten aus großer Entfernung abgeschossen werden und Menschen empfindlich verletzen, sogar töten. Sie trugen entweder Symbole oder Sprüche, die sehr bösartig sein konnten. Einige dieser Schleudergeschosse sind erhalten, vor allem die aus dem Perusinischen Krieg (41/40 v. Chr.) weisen äußerst aggressive Sprüche auf. Das achte Kapitel widmet sich obszönen Schimpfwörtern: Futuere und co. Das lateinische F***-Wort und weiteres sexuelles Vokabular (94-104). Auf Graffiti in Pompeji geht Weeber im neunten Kapitel ein: Einblicke ins pralle Alltagsleben. Graffiti auf pompejanischen Wänden (105-117). Weeber leitet seine Gedanken mit einem selbstironischen ‚Spruch‘ ein, der dreimal überliefert wurde:
Admiror, paries, te non cecidisse ruinis,
qui tot scriptorum taedia sustineas.
„Ich bewundere dich, Wand, dass du noch nicht zusammengebrochen bist, / die du doch das blöde Zeug so vieler Schreiber aushalten musst.“ (105)
Während viele Graffiti im Lauf der Zeit zerstört wurden, haben sich zahlreiche Beispiele in Pompeji und Herculaneum wegen des Vesuvausbruchs im Jahre 79 n. Chr. erhalten. Die viele Meter hohe Ascheschicht hat die Häuser bedeckt, bis Archäologen sie ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wissenschaftlich ausgruben. Weeber stellt verschiedene Typen von Graffiti vor, mit zahlreichen Textbeispielen, die man auch im Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) nachlesen kann.
Im letzten und zehnten Kapitel liegt das Hauptaugenmerk auf den Carmina Priapea und auf der obszönen Hardcore-Poesie (118-123). Namenspate ist der Gott Priapus, dessen besonderes Merkmal ein erigierter Penis ist. Der Dichter Martial befasste sich thematisch mit dieser Gottheit in einigen Spottepigrammen. Ein anonymer Dichter des 2. Jahrhunderts n. Chr. hat ein ganzes Buch dem Gartengott Priapus gewidmet. Weeber hat einige Gedichte ausgewählt und mit Übersetzung abdrucken lassen.
Insgesamt bietet Weeber eine kurzweilige Lektüre für Leserinnen und Leser, die sich mit polemischen Ausdrücken/Lexemen in der Antike befassen möchten. Die Römer haben nicht nur große Dichter wie Horaz, Ovid und Vergil hervorgebracht, sondern auch Autoren und anonyme Verfasser von Texten, in denen zahlreiche Schimpfwörter die damaligen Zuhörer möglicherweise fasziniert haben. Ob eine Lehrkraft die Thematik im Unterricht behandelt, muss jede Lehrerin/jeder Lehrer selbst entscheiden.
Dietmar Schmitz
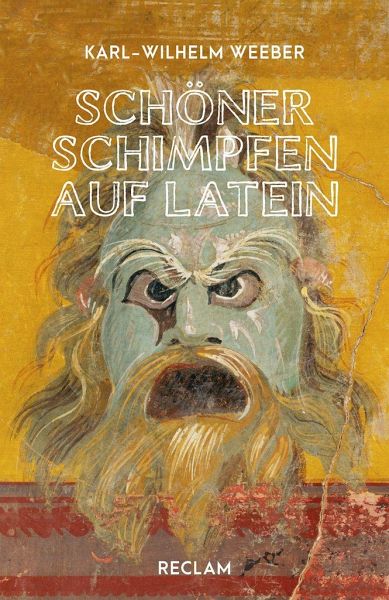
Mai 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Demandt, A., (2022) Diokletian. Kaiser zweier Welten. Eine Biographie. München 2022. 432 S. EUR 32,- (ISBN 978-3-406-787317).
Alexander Demandt hat zahlreiche Monographien und viele Aufsätze verfasst. Besonders hervorheben möchte ich drei Opera: Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken (München 1978), Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil der Nachwelt (München 1984) und: Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284–565 n. Chr. (Handbuch der Altertumswissenschaft, dritte Abteilung, sechster Teil). 2. vollständig bearbeitete und erweiterte Auflage (München 2007). Drei Biographien stammen aus seiner Feder, die erste zu Alexander dem Großen (Leben und Legende, München 2009), die zweite zu Pontius Pilatus (München 2012) und die dritte zu Marc Aurel (Der Kaiser und seine Welt, München 2018). Nun folgt eine weitere Biographie, nämlich die zu Kaiser Diokletian.
Bereits im Vorspruch (9-10) liefert Demandt außer den üblichen Dankesworten wichtige Hinweise auf die Einteilung der römischen Geschichte und damit auch Erklärungen für einen Teil des Titels seines Buches (übrigens nach Aussagen des Autors das dreißigste für das Verlagshaus Beck, 10). Nach Demandt gliedert sich die römische Geschichte in die Zeit der Republik und die Kaiserzeit. Die erste große Periode endet mit der Seeschlacht bei Actium 31 v. Chr., während die Kaiserzeit als die zweite Großperiode „nach der Diktatur Caesars (49-44) seit der Sicherung der Alleinherrschaft des Augustus (27 v. Chr. bis 14 n. Chr.)“ folgt (9). Nach der Severerdynastie (235 n. Chr.) wird die Zeit der Soldatenkaiser angesetzt, die „den Übergang zur Spätantike“ (9) darstellt und „damit die Kaiserzeit in die Phasen des Prinzipats und des Dominats“ (9) unterteilt. Die zuletzt genannte Phase beginnt mit Kaiser Diokletian im Jahre 284 (und Constantin 306) und endet im Westteil des römischen Reiches mit Romulus Augustulus (476). Demandt erkennt im Wirken Diokletians „eine doppelte Zugehörigkeit, auf eine Position als Kaiser zweier Welten“ (9). Er kann als letzter Soldatenkaiser und aufgrund verschiedener Aspekte als erster Kaiser der Spätantike betrachtet werden. Zu diesen Aspekten zählt Demandt die folgenden: „erfolgreiche Reformen, Verlagerung der Regierung von Rom an die Grenzen, den Hauptstadtwechsel, die Neugliederung der Provinzen und die Festschreibung des Hofzeremoniells“ (9/10). Damit sind entscheidende Themen bereits angeschnitten, die Demandt in seinem Buch ausführlich behandelt.
Demandt spricht im Falle des Kaisers Diokletian von Alleinstellungsmerkmalen im Vergleich mit anderen Herrschern der römischen Geschichte: ursprünglich stammt der Protagonist aus dem Sklavenstand, ihm gelang die Freilassung, der steile Aufstieg über den „Kriegsdienst und die Offizierslaufbahn zum Kaisertum war einzigartig“ (10). Unvergleichlich war die von Diokletian kreierte Viererherrschaft (Tetrarchie) von zwei Augusti und zwei Caesares, seine vergeblichen und letztmaligen Bemühungen, das Christentum zu eliminieren, da es nicht zur „gesamtantiken Religiosität“ passte (10), „die misslungene umfassende Preiskontrolle und die Abdankung nach einer geplanten Regierungszeit von zwanzig Jahren mit geregelter Nachfolge“ (ebenda).
In dreizehn Kapiteln versucht Demandt Leben, Wirken und Scheitern des Kaisers darzustellen. Ihm gelingt es in überzeugender Art und Weise, wichtige Stationen zu beschreiben und auch zu kommentieren. Dabei geht er zunächst ausführlich im ersten Kapitel auf die Quellen ein, die ihm als Forscher zur Verfügung standen (Die Quellen unseres Wissens, 13-20). Wie bei Demandt üblich, erläutert er präzise seine Vorgehensweise und auch die Begriffe, deren er sich bedient. So legt er eine Definition für den Terminus Quelle vor: „Eine Quelle ist das Ende eines Vorgangs und der Anfang seiner Erkenntnis“ (13). Dabei differenziert er zwischen zwei Typen von Quellen: einerseits die Historiographie und die Inschriften, andererseits die Gelegenheitsreden, Papyri und Münzen. Er betont auch, dass stets geprüft werden muss, ob die Quellen verlässlich sind und ob der Informationsgehalt stimmig ist. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Demandt nicht nur eine Biographie schreibt, sondern dass er immer darauf achtet, den Leserinnen und Lesern seine gewählte Methodik, die Aufgaben der Geschichtsschreibung und die benutzten Begriffe genau zu erläutern. Allein aus diesem Grunde ist die Lektüre dieses Buch allen Studierenden des Fachs Geschichte dringend empfohlen, da sie am Beispiel einer bedeutenden Herrscherfigur am Ende der Epoche der Soldatenkaiser und der beginnenden Spätantike wesentliche handwerkliche Zugriffsmöglichkeiten eines Historikers erkennen und erlernen können. Gut unterrichtet sind wir aufgrund der Quellenlage für die Zeit bis zum Jahr 229, etwa durch die Nachrichten eines Cassius Dio. Demgegenüber ist die Quellenlage für die Epoche der Soldatenkaiser und der Tetrarchie recht dürftig, da es keinen „erhaltenen zeitgenössischen Darsteller“ gibt (14). En passant erhält man als Leserin/Leser wertvolle Informationen über die Epochen vor und nach Diokletian. So verweist Demandt auf einen Textfund aus der Wiener Hofbibliothek des Jahres 2014, nämlich auf die <Scythica Vindobonensis> (15). Hierbei handelt es sich um Pergamentblätter, die der flämische Humanist Ogier Ghiselin von Busbeck 1562 nach Wien gebracht hat. Auf diese Weise entsteht ein dichtes Gewebe von Informationen um Diokletian, rückblickend bis in die griechische Geschichte, vorausblickend bis in unsere Zeit. Demandt verliert allerdings nie den Blick auf wesentliche Aspekte, auch wenn er zuweilen abzuschweifen scheint. Diese Exkurse sind aber sehr wichtig, um bestimmte Fakten besser einordnen zu können. Der emeritierte Berliner Professor für Alte Geschichte geht auf weitere Quellen ein (panegyrische Texte, solche der Kirchenväter, sowie von byzantinischen Autoren), die ich hier nicht alle auch nur benennen könnte. Dafür empfiehlt der Rezensent die aufmerksame Lektüre des gesamten Buches.
Im zweiten Kapitel (Die Anarchie unter den Soldatenkaisern, 21-36) geht Demandt auf das Ende der Severerzeit ein, liefert Informationen zu den ersten Soldatenkaisern, beschreibt den Tiefstand unter Gallienus in den Jahren 260 bis 268, um anschließend den Beginn einer Phase der Konsolidierung zu erörtern. Auch in diesem Kapitel ist der Historiker erfolgreich darum bemüht, sprachliche Erläuterungen zu den geschichtlichen Aspekten zu liefern. Im Zusammenhang mit dem Übergang von der Epoche des Prinzipats in die Spätantike sprachen Wissenschaftler von einer ernsten Krise des Reiches unter den Soldatenkaisern. Demandt bietet eine Erklärung für die Etymologie des Wortes Krise, nämlich abgeleitet aus dem griechischen Verb krinein/entscheiden (22). Er erinnert daran, dass die hippokratische Medizin das Wort krisis verwendet, wenn die Entscheidung anstand, „ob ein Patient stirbt oder überlebt“ (22). Es bestand durchaus die Gefahr, dass die Einheit des römischen Reiches verlorenging. Der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt hat später die geschichtlichen Krisen untersucht und einen vielbeachteten Abschnitt verfasst (in: Ders., Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1868, im Nachlass 1905 erschienen und in einer von Rudolf Marx erläuterten Ausgabe publiziert, Stuttgart 1978). In einer Anmerkung (4, S. 320) liefert Demandt weitere Literaturangaben zum Thema, was eine geschichtliche Krise „eigentlich“ ist. Man kann sich also mit den Interpretationen des Berliner Althistorikers begnügen, man kann aber intensiver die Sekundärliteratur prüfen und noch tiefer in die Thematik eindringen. Das dritte Kapitel trägt den Titel: Die Erhebung Diokletians 284/285, 37-52. Hier geht Demandt – wie es sich für eine Biographie gehört – auf die Herkunft, den Namen und die Familie des Kaisers ein. Der vollständige Name, der auch erklärt wird, lautet auf offiziellen Dokumenten: Imperator caesar caius aurelius valerius diocletianus pius felix invictus augustus pontifex maximus tribunicia potestate consul pater patriae proconsul. Die Quellen belegen, dass Diokletian aus Dalmatien stammte, sich im Heer hochgedient hat und auch Latein sprach. Dagegen waren seine Griechischkenntnisse spärlich, ja sie wurden sogar abfällig eingeschätzt (41). Während bis zu Caracalla die Geburtstage aller Kaiser bekannt waren, danach lediglich in Ausnahmefällen, kann man im Falle Diokletians nur das Geburtsjahr erschließen: 248 n. Chr. Diokletian stammte aus kleinsten Verhältnissen, obscurissime natus. An diesem Beispiel zeigt sich die Neigung Demandts, wenn möglich für deutsche Begriffe die lateinische Entsprechung zu bieten. Im weiteren Verlauf geht der Historiker auf zahlreiche Details von Namen, Familie und Umfeld Diokletians ein. Wichtig ist auch der Abschnitt über Nikomedien als Hauptstadt (50-52). Die Verlagerung des Hauptsitzes kann als erste bedeutende Maßnahme der Reformen Diokletians angesehen werden. Nach Rom kam der Kaiser nur einmal, nämlich 303 n. Chr. anlässlich seiner Vicennalien (52), als er sein zwanzigjähriges Regierungsjubiläum feierte.
Im vierten Kapitel (Das Experiment der Tetrarchie, 53-71) wird die besondere Herrschaftsform, die Diokletian erfunden hat, erläutert. Es gab aber Vorläufer, die als Kaiser nicht nur den eigenen Sohn als Nachfolger festgelegt haben, sondern wie Marc Aurel, der „seinen Adoptivbruder Lucius Verus zum gleichberechtigten Augustus und Mitherrscher“ auswählte (54). Die militärische Lage verlangte nicht nur einen Machthaber, sondern mindestens zwei. Daher war die Idee eines „regionalen Mehrkaisertum“ keine Neuerung, die Diokletian erfunden hätte (54). Demandt erklärt den Begriff ‚Tetrarchie‘ genau, der sich erst am Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzte (60). Bei Laktanz (MP.18,5) heißt es: ut duo sint in re publica maiores, qui summam rerum teneant, item duo minores, qui sint adiumento – „auf dass im Staat zwei Größere regierten, denen die höchste Entscheidung oblag, und zwei Kleinere zur Unterstützung“ (60). Bei Ammianus Marcellinus werden die Caesares als apparitores/gehorsame Gehilfen der Augusti bezeichnet (60). Auf den folgenden Seiten zeichnet Demandt die weitere Entwicklung der neuen Herrschaftsform nach, geht auf die Herkunft der Caesaren ein, erläutert die Aufgabenbereiche und prüft, wie die Tetrachie in der Kunst dargestellt wurde. Hier wie auch in anderen Fällen zieht der Historiker passende Bilddokumente heran. Wenn die vier Herrscher auch gleichberechtigt waren, so behielt sich Diokletian die Ernennung der Konsuln vor (66). Auch in den bildnerischen Darstellungen lassen sich feine Unterschiede erkennen: „In allen diesen Monumenten herrscht Gleichheit unter den Tetrarchen mit dezenten Rangunterschieden zwischen den Augusti und den Caesaren in der Platzierung und in der Größe“ (70). Im fünften Kapitel widmet sich Demandt den Kämpfen im Osten (75-99). Konflikte zwischen Ost und West gab es bereits in mythischer Zeit, sie wurden seit Herodot thematisiert. Demandt behandelt die Entwicklung in den verschiedenen Regionen, etwa die der Parther, Sarazenen oder Ägypter. Immer wieder nimmt er Rückblicke vor, gerne auch unter Verwendung lateinischer Begriffe, etwa wenn es um den Einzug (adventus, introitus) der Kaiser geht oder bei der Bezeichnung von Amtsträger, wie im Falle des Ammianus Marcellinus (protector domesticus,84). Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn es ein Register mit all diesen lateinischen Begriffen gäbe. Dies würde auch die große Bandbreite zeigen, in der sich Demandt bewegt.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Sicherung des Westens (101-122). Der Nord-Süd-Konflikt war in der Geschichte Roms stets gefährlicher als der Ost-West-Konflikt. Auch hierzu bietet Demandt einige Beispiele, damit man die Situation zur Zeit Diokletians besser einordnen kann. Mehrere Völker des Westens und die Auseinandersetzungen mit Rom stehen in diesem Kapitel im Fokus.
Der Reichsreform gilt das siebte Kapitel (123-156), während Geld und Wirtschaft im Mittelpunkt des achten Kapitels stehen (157-175). Die Leserinnen und Leser erfahren in beiden Kapiteln viele interessante Details über das Hofzeremoniell, über Insignien und die Titulatur sowie über die Staatsfeste. Immer wieder erläutert Demandt wichtige Begriffe, so zum Beispiel das lateinische Wort corona. Ebenso geht der Forscher auf die Geschichte des Throns ein und erklärt Bedeutung und Historie des Zepters (133). Auf diese Weise entsteht gewissermaßen eine Kulturgeschichte der Menschheit. Fehlen durften natürlich nicht Hinweise zur Gesetzgebung und Rechtsprechung. „Hunderte von Entscheidungen Diokletians gingen ein in den Codex Justinianus und damit ins Corpus Iuris Civilis, das die europäische Rechtstradition geprägt hat.“ (156). Während im Ostteil des römischen Reiches Griechisch die vorherrschende Sprache war, war Latein im Westteil die Sprache, die die Menschen verwendeten. Für den Bereich des Rechts und des Militärs gilt Latein als die Sprache im gesamten römischen Reich. Berytos/Beirut war das Zentrum des römischen Rechts, dort wurde Latein gesprochen und geschrieben. Im achten Kapitel erörtert Demandt Aspekte wie Prägestätte, Münzpropaganda, Steuern, Frondienste, Staatsausgaben und die Finanzlage insgesamt. In die Geschichte eingegangen ist der von Diokletian verfügte Maximaltarif, das Edictum de pretiis rerum venanium (167ff.). In der Regel scheiterten die meisten Versuche, Höchstpreise für Waren festzulegen. Wenn es ungünstig verlief, wurden die Waren einfach vom Markt genommen. Es gab sogar Stimmen, die meinten, die Finanzlage des römischen Reiches habe den Niedergang der antiken Kultur bedeutet. Peter Heather vertrat die Auffassung, dass man mit Geld Rom hätte retten können (174).
Aufschlussreich ist auch das neunte Kapitel, in dem die Christenverfolgung thematisiert wird (177-204). Demandt geht auf die verschiedenen Religionen im römischen Reich ein und beleuchtet die zehn Christenverfolgungen seit Nero. Die kirchliche Überlieferung nennt diese Zahl, während Demandt die Auffassung vertritt, dass es unter Diokletian die erste und einzige Christenverfolgung gegeben habe, „wenn man darunter, wie üblich, ein reichsweites Religionsverbot versteht“ (186). Diokletian hatte lange damit gezögert, solche Verfolgungen durchzuführen. Durch Laktanz sind wir über Beginn und Verlauf gut unterrichtet. Entscheidend war das Edikt, dass Kaiser Diokletian im Februar 302 erließ (191). Über seine Beweggründe kann man nur spekulieren. Demandt behandelt auch die Haltung der christlichen Autoren im Zusammenhang mit den Verfolgungen und den Widerständen gegen das Christentum (201-204). In den weiteren Kapiteln erläutert Demandt die Umstrukturierung des Heeres (Das neue Heer, 205-221), stellt die Bauten der Tetrarchen (223-255) vor, um dann die Umstände der Abdankung, des Todes und der Nachfolge (257-275) zu erörtern. Zum Abschluss werden die Leserinnen und Leser über die Rezeption informiert: Diokletian nach Diokletian (277-307).
Es gibt einige Anhänge zu verschiedenen Kapiteln (301-317), dann folgen die Anmerkungen (319-384), die Tetrarchen-Tabelle (385), die Stammtafel zur Tetrarchie (387-388), die Chronik (389-394). Daran schließen sich Karten an (396-397), Abkürzungen (399-400) und ein Literaturverzeichnis mit mehrfach angeführten Publikationen (401-411) sowie ein Abbildungsnachweis (413-414) und das Register (415-432), von Aachen bis Zypern.
Demandt hat nicht nur eine Biographie über Kaiser Diokletian vorgelegt, sondern liefert viele aufschlussreiche und interessante Details über die anderen Tetrarchen und über seine Konzeption von Herrschaft mit zwei Augusti und zwei Caesares. Dabei erfahren die Leserinnen und Leser zahlreiche Hintergrundinformationen zur gesamten römischen Geschichte mit Ausblicken in unsere Zeit. Demandt nimmt Rückblicke und Vorausblicke vor, um bestimmte Details besser verständlich zu machen. Dabei stützt er sich auf wichtige Quellen, so dass jede Leserin und jeder Leser sich gegebenenfalls selbst ein Bild machen kann über die vom Autor vorgelegten Beobachtungen und Thesen. Insgesamt ist die Lektüre anregend, nie langweilig, da die Texte flüssig geschrieben und die meisten wissenschaftlichen Belege in den Anmerkungen zu finden sind und daher die Lektüre der einzelnen Abschnitte nicht beeinträchtigt. Auch Bilddokumente und andere wichtige Quellen wie Münzen werden gut nachvollziehbar interpretiert. Das Buch gehört in die Bibliothek eines jeden/einer jeden, die sich für römische Geschichte interessiert, und wird mit Sicherheit zu einem Standardwerk avancieren.
Dietmar Schmitz
April 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Der Westfälische Frieden. Lateinisch/deutsch. Herausgegeben, übersetzt und mit Erläuterungen und einem Nachwort versehen von Gerd Flemmig. Ditzingen: Reclam 2021. 399 S., 14,80 €.
„′s ist Krieg! ′s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, / Und rede du darein! / ′s ist leider Krieg - und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein!“ Dieses berühmte „Kriegslied“ des Matthias Claudius aus dem Jahr 1778 spricht ebenso von der tiefen Sehnsucht nach Frieden in Zeiten des Krieges wie Immanuel Kants immer noch fundamentale Schrift „Zum ewigen Frieden“ (1795) oder Joseph Haydns Missa in tempore belli (1796). Dabei war doch schon eineinhalb Jahrhunderte zuvor der weltweite Friede ausgerufen worden nach den lange nachwirkenden, traumatischen Erfahrungen des Dreißigjährigen Kriegs (Herfried Münkler, Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618–1648, Berlin 2017) – der in Münster und Osnabrück verhandelte und geschlossene, auf unbegrenzte Dauer angelegte Westfälische Frieden von 1648.
Die Dokumente dieser Instrumenta Pacis hat nun Gerd Flemmig (den Besuchern der DAV-Kongresse als Leiter von Arbeitskreisen wohl vertraut) in einer handlichen und preisgünstigen Ausgabe zweisprachig verfügbar gemacht. Den Kern bilden selbstverständlich die beiden Verträge, der von Osnabrück mit den Bestimmungen für das Reichsgebiet, der von Münster mit den Bestimmungen über das Verhältnis zwischen Frankreich und dem Reich (jeweils mit einem Inhaltsverzeichnis versehen). Es beginnt mit der aufs Ganze zielenden Formulierung pax sit Christiana, universalis, perpetua veraque et sincera amicitia inter Sacram Caesaream Maiestatem, Domum Austriacam …, um dann sehr detailliert und kleinteilig voranzuschreiten und jede Region oder jeden Sachverhalt von Relevanz auch explizit zu regeln, z.B. (Art. 11, § 1)
Pro aequivalente autem recompensatione Electori Brandenburgico, Domino Friderico Wilhelmo, quod ad promovendam pacem universalem iuribus suis in Pomeraniam Citeriorem et Rugiam una cum ditionibus locisque supra annexis cesserit, praestanda, eidem eiusdemque posteris et successoribus, haeredibus atque agnatis masculis, cumprimis Dominis Marchionibus Christiano Wilhelmo, olim Administratori Archiepiscopatus Magdeburgensis, item Christiano Culmbacensi et Alberto Onolsbacensi eorundemque successoribus et haeredibus masculis, statim ac pax cum utroque Regno et Statibus Imperii composita et ratificata fuerit, a S. Caesarea Maiestate de consensu Statuum Imperii et praecipue interessatorum tradatur Episcopatus Halberstadiensis cum omnibus iuribus, privilegiis, regalibus, territoriis et bonis secularibus et ecclesiasticis, quocunque nomine vocatis, nullo excepto, in perpetuum et immediatum feudum. Constituatur item Dn. Elector statim in possessione eiusdem quieta et reali eoque nomine sessionem et votum in Comitiis Imperii et Circulo Inferioris Saxoniae habeat.
Als gleichwertige Entschädigung soll dem Kurfürsten von Brandenburg, dem Herrn Friedrich Wilhelm, weil er zur Förderung des allgemeinen Friedens auf seine Rechte in Vorpommern und auf Rügen einschließlich der dazugehörigen zuvor erwähnten Herrschaften und Orte für sich und seine Nachkommen, Nachfolger, Erben und männlichen Anverwandten, insbesondere für die Herren Markgrafen Christian Wilhelm, den einstigen Administrator des Erzbistums Magdeburg, sowie für Christian von Kulmbach und Albrecht von Ansbach sowie für deren männliche Nachfolger und Erben, verzichtet hat, sofort, sobald der Frieden mit beiden Königreichen und den Reichsständen geschlossen und ratifiziert worden ist, von der Kaiserlichen Majestät mit Zustimmung der Reichsstände und besonders der unmittelbar beteiligten das Bistum Halberstadt mit allen Rechten, Privilegien, Regalien, weltlichen und geistlichen Gebieten und Gütern, welchen Namen auch immer diese haben mögen, ohne Ausnahme als immerwährendes und unmittelbares Reichslehen übertragen werden. Ebenso soll der Herr Kurfürst sogleich in den ungestörten und tatsächlichen Besitz dieses Bistums eingesetzt werden und unter diesem Namen Sitz und Stimme auf den Reichstagen und im Niedersächsischen Kreis haben. Etc. etc.
Die Passage gibt auch einen Einblick in den lateinischen Duktus des Originals sowie des sachlichen Stils der Übersetzung. Da die Rechtssprache des 17. Jahrhunderts auch mit guten Kenntnissen der klassischen Latinität nicht immer unmittelbar verständlich ist, hat Flemmig ein eigenes erläuterndes Kapitel zu den sprachlichen Besonderheiten (291-303, hauptsächlich eine Wortliste) beigegeben. Das ist ebenso hilfreich wie die Anmerkungen und die Zusammenstellung von Begriffen, Verträgen und Ortsnamen sowie der an den Verhandlungen beteiligten Personen. Nur bei der Landkarte mit den Friedensschlüssen (364-365) kommt das Format eines Reclam-Heftes und der Graustufendruck an seine Grenzen, hier wäre ein zusätzlicher externer Link sinnvoll gewesen. Insgesamt ist aber auch diese Appendix sehr sorgfältig gearbeitet, auch kleinere Versehen sind selten (etwa S. 285, wo die den Jesuitenorden begründende päpstliche Bulle nicht „Regimini ecclesiae militaris“, sondern „Regimini militantis ecclesiae“ heißen muss – wohl nach F.M. Oertel, Die Staatsgrundgesetze des deutschen Reiches, Leipzig 1841, 309, Anm. 24 mit ähnlichem Duktus). Das Buch wird durch eine ausführliche, die Weiterarbeit ermöglichende Bibliographie beschlossen sowie durch ein Nachwort, das noch einmal Voraussetzungen, Kriegsverlauf, Ablauf und Inhalte der Verhandlungen sowie die Folgen knapp darstellt. Auch wenn nicht klar gesagt wird, wer die Zielgruppe ist, so lässt sich neben den allgemeininteressierten Lesern vor allem an den (vertieften) Geschichtsunterricht denken, aber auch für einen Ausflug in die Neuzeit im Rahmen des Lateinunterrichts ist ein Fundament gelegt, auf dem je nach unterrichtlicher Situation spezifisch aufgebaut werden kann.
Flemmig verzichtet auf vordergründige Aktualisierungen und überlässt es den Leser:innen, ihre eigenen gegenwärtigen Erfahrungen in historischer Brechung wiederzufinden – Erfahrungen, die seit dem 24. Februar 2022 eine bis dahin ungeahnte Nähe von Krieg und Hoffnung auf Frieden enthalten. Aber die Lektüre der Instrumenta Pacis zeigt auch, dass ein Friede sorgfältig ausgehandelt und gesichert werden muss, dass eben viele Details zu bedenken sind und dass es auch Instrumentarien geben muss, um die allseitige Einhaltung zu garantieren.
Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

März 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Madeline Miller, Galatea. Erzählung, illustriert von Thomke Meyer, Madeline Miller, Galatea. Erzählung, illustriert von Thomke Meyer, München (Eisele) 2022, ISBN 978-3-96161-141-6, € 20,00
Pygmalions Geschichte ist, eingewoben in die tragische Erzählung des Orpheus, insbesondere durch Ovid bekannt: Die Erschaffung und Verwandlung der unvergleichlichen Statue in eine echte Frau mit Hilfe der Göttin Venus sowie die Eheschließung, die durch das Kind Paphos gesegnet wird, ist Thema einer Sage, die Orpheus nach dem erneuten und endgültigen Verlust seiner Eurydike preisgibt (Ov. met. 10,243–297). Während die Geschichte des antiken Dichters mit der Erwähnung der Empfängnis endet, beginnt Millers Kurzgeschichte nach einem weiteren Zeitsprung von zehn Jahren und gibt Galatea, dem einstigen Kunstwerk, neben ihrem Namen auch noch eine Stimme und einen starken Willen, um ihre Gefühle und Sicht der Ereignisse auszudrücken und nach ihren Interessen zu handeln. Wie in ihren anderen Werken („Das Lied des Achill“ und „ Ich bin Circe“) entsteht das W(underw)erk also durch einen deutlichen Perspektivwechsel. In ihrem Vorwort beschreibt Miller Pygmalion als Prototyp des Incel und macht bereits damit klar, was sie vom ursprünglichen Blickwinkel des Mythos hält. Gestärkt wird von ihr indes die feminine Willenskraft der Mütter, die keine Grenzen kennt. So befindet sich Galatea in der fingierten Fortsetzung des Mythos eingesperrt in ärztlicher Betreuung, da sie versucht hatte, gemeinsam mit ihrer Tochter dem lieblosen Pygmalion zu entkommen. Um ihrem Kind ein besseres Leben ermöglichen zu können, fasst Galatea einen Plan, den sie entschlossen und trotz aller eigenen Einbußen umsetzt.Das Opusculum wird mit einem Vorwort geziert, enthält für den eigenen Abgleich die Holzberg-Übersetzung der ovidischen Fassung und schließt mit einem Nachwort Knabls. Eine besonders künstlerisch ansprechende Gestaltung wird durch die in Blautönen gehaltene Illustration Meyers erreicht, die sowohl die Stimmung als auch das Ende der Geschichte zu unterstreichen sucht.
Anna Stöcker
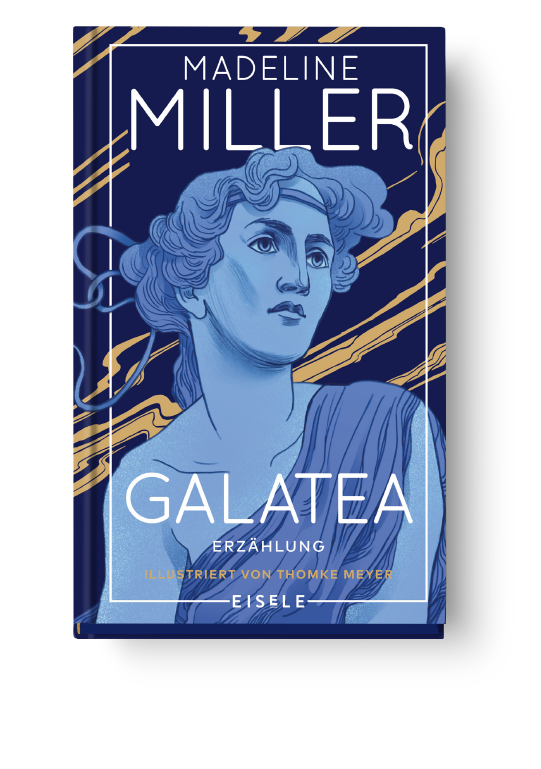
Februar 2023
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Andreas Fritsch: Schriften
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/view/schriftenreihen/sr-77.html
Ce n'est pas un livre – es hätte aber eines werden können: In einer noch gar nicht so weit zurückliegenden Zeit war es akademischer Brauch, die „Kleinen Schriften“ eines Forschers noch einmal zwischen Buchdeckel zusammenzufassen und auf diese Weise wieder verfügbar zu machen, oder auch nicht: Denn diese Sammlungen fanden nur selten eine Verbreitung über die Sammelband-Abteilungen der universitären Spezialbibliotheken hinaus, die einzelnen Beiträge waren für Externe dann doch nur auf dem bisweilen recht bürokratischen Fernleihweg erhältlich.
Die Digitalisierung auch der Geisteswissenschaften hat – ein wenig im Verborgenen - neue Möglichkeiten geschaffen. Besonders für die Altertumswissenschaften hervorzuheben ist das Propylaeum-Projekt (https://www.propylaeum.de/), das von der UB Heidelberg und der Bayerischen Staatsbibliothek München getragen wird, und zu dem neben Bibliothekskatalogen, Datenbanken sowie dem Netzwerk recensio.antiquitatis auch eine elektronische Publikationsplattform (https://www.propylaeum.de/publizieren) gehört, die Buchpublikationen genauso einen Ort gibt wie ganzen Schriftenreihen oder – in unserem Fall relevant – die Wiederveröffentlichung von Zeitschriftenaufsätzen ermöglicht, die anders als etwa bei academia.edu nicht kommerziellen Interessen folgt.
Dafür zunächst einige Beispiele:
- Bucherstpublikation: Marc Brüssel, Altsprachliche Erwachsenendidaktik in Deutschland: Von den Anfängen bis zum Jahr 1945, Heidelberg: Propylaeum, 2018. https://doi.org/10.11588/propylaeum.369.522
- Buchzweitpublikation: Stefan Kipf, Altsprachlicher Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland: Historische Entwicklung, didaktische Konzepte und methodische Grundfragen von der Nachkriegszeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, Heidelberg: Propylaeum, 2020. https://doi.org/10.11588/propylaeum.618
- Publikationsreihe: Acta Didactica Classica. Bielefelder Beiträge zur Didaktik der Alten Sprachen in Schule und Universität, https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/series/info/adclass
- Zeitschriften: Forum Classicum - https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fc/index
sowie die Vorgängepublikation „Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbands“: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mdav%20
Andreas Fritsch (geb. 1941) muss kaum vorgestellt werden. Als Berliner Lehrer, Professor an der Pädagogischen Hochschule und dann an der Freien Universität (eine Reihe von Jahren auch für Humboldt-Universität zuständig) und nicht zuletzt seit 1991 als Redaktor der MDAV und des Forum Classicum hat er über viele Jahre oder besser: Jahrzehnte die altsprachliche fachdidaktische Diskussion mitgeprägt. In dieser Zeit sind zahlreiche Beiträge entstanden, die heute noch relevant, aber nicht leicht an ihren Originalpublikationsorten aufzufinden sind (vgl. https://www.klassphil.hu-berlin.de/de/personen/fritsch).
Nun lassen sich aber die Digitalisate von aktuell (Stand Mitte Januar 2023) von neunzehn dieser Publikationen bequem lesen (weitere Veröffentlichungen scheinen geplant). Die Reihe beginnt mit einem langen Aufsatz, in dem sich Bildungsgeschichte und aktuelle didaktische Fragen verbinden, nämlich zu „Sprache und Inhalt lateinischer Lehrbuchtexte. Ein unterrichtsgeschichtlicher Rückblick“ Nr. 1, 1976), worin – das ist typisch für Fritsch – der Blick auf die Tradition seit der frühen Neuzeit (immer wieder erscheinen Comenius und Gedike) als Maßstab für die aktuelle Praxis dient. Auch wenn seither mehrere Lehrbuchgenerationen ihren Weg in die Schulen und auch wieder heraus gefunden haben, so sei dieser Text allen Verfassern von Lateinbüchern ans Herz gelegt (und natürlich auch den Verlagsverantwortlichen). Mit der Geschichte des altsprachlichen Unterrichts befassen sich auch Nr. 10 (zu Wilamowitz), 28 (Zeittafel zum altsprachlichen Unterricht in Berlin von 1945 bis 1990), 29 (40 Jahre DAV Berlin), 48 (Comenius) sowie 49 und 52 (zu Gedike).
Einer von Fritsch‘ Lieblingsautoren ist Phaedrus, dem er sich in Nr. 16, 25 und 30 in unterschiedlichen Facetten nähert. Dass Latein nicht nur geschrieben, sondern auch gesprochen gehört, hat Fritsch in zahlreichen officinae Latinae auf den DAV-Kongressen und darüber hinaus immer wieder mit Nachdruck vertreten. Nachlesen kann man diese Position in Nr. 13, 33 und 44. Konkret der (zur Entstehungszeit) aktuellen fachdidaktischen Debatte wendet sich Fritsch in Nr. 34, 38 und 40 zu.
Schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich in der keineswegs beliebig bunten, aber abwechslungsreichen Reihe auf Schritt und Tritt lohnende Anregungen zum Nach- und Weiterdenken (wieder)entdecken. Wer beispielsweise den kleinen Aufsatz über die „Antike im Spiegel Berliner Straßennamen“ gelesen hat, wird künftig bewusster durch diese Stadt gehen.
Diese Sammlung der Schriften von Andreas Fritsch zeigt auch exemplarisch, wie die Digitalisierung dazu beitragen kann, dass einmal Geschriebenes aus dem kollektiven Gedächtnis nicht so leicht verschwindet. Denn die Beiträge sind (wie alle vergleichbaren Sammlungen bei Propylaeum) nicht nur über die Suchfunktion oder als Katalog auffindbar, sondern auch über die einschlägigen Suchmaschinen zu ermitteln: Quod non est in Google, non est in mundo – dem ist hiermit Rechnung getragen.
Ulrich Schmitzer, HU Berlin



