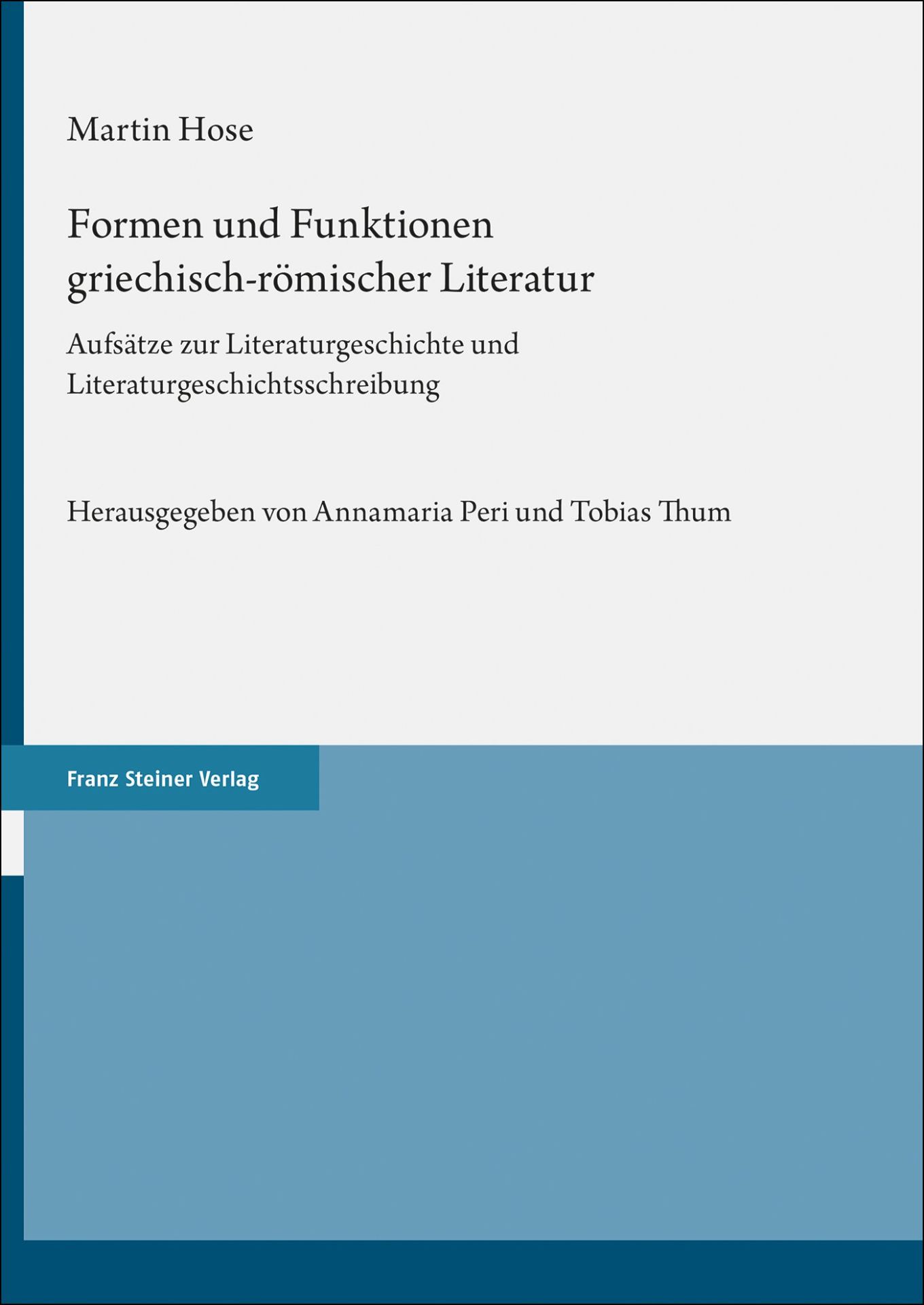Neuerscheinung des Monats
März 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Jennifer Saint, Ich, Ariadne. Roman. Übersetzt aus dem Englischen von Simone Jakob, Berlin (Ullstein) 2022, ISBN 978-3-548-06708-7, 416 Seiten, € 16,99 (Englische Originalausgabe: Ariadne, London 2021)
Die britische Schriftstellerin Jennifer Saint hat am King’s College in London unter anderem Altphilologie studiert. In ihrem Debütroman „Ich, Ariadne“ widmet sie sich der Neuinterpretation eines bzw. mehrerer klassischer griechischer Mythen, wobei der zentrale Latinist:innen beispielsweise auch durch Ovids zehnten Heroides-Brief bestens bekannt ist. Die Übersetzung von Simone Jakob fängt die kraftvolle und anschauliche Sprache der Autorin gut ein, sodass die atmosphärische Dichte und Emotionalität im Deutschen erhalten bleiben.
Aus den Perspektiven von Ariadne und Phädra, den Töchtern von König Minos von Kreta und Schwestern des Minotaurus, schildert Saint deren Leben im Palast von Knossos, auf der Insel Naxos und in Athen. Die beiden Figuren fungieren als Ich-Erzählerinnen, wobei Ariadne – wie der Titel bereits impliziert – insgesamt präsenter ist. Untergliedert ist der Roman in vier Teile, die verschiedene Lebensabschnitte Ariadnes (die Flucht aus Kreta, das Leben auf Naxos, das Wiedersehen mit Phädra, der Konflikt zwischen Dionysos und Perseus) schildern: Ihr Leben ist geprägt von Verrat, familiären Konflikten und dem Streben nach Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung. Nach ihrem eigenen Verrat an ihrer Familie und Kreta, indem sie dem Gefangenen Theseus hilft, den Minotaurus zu töten, wird Ariadne von diesem im Laufe der gemeinsamen Flucht auf der Insel Naxos zurückgelassen. Dort begegnet sie später dem Gott Dionysos, heiratet ihn und genießt zwischenzeitlich ein glückliches und abgeschiedenes Leben. Währenddessen muss Ariadnes Schwester Phädra Theseus heiraten und verbringt in Athen als dessen Gattin ein liebloses Leben – bis sie Hippolytus, Theseus‘ Stiefsohn, kennenlernt. Von diesem zurückgewiesen begeht Phädra schließlich Suizid, woraufhin Theseus fälschlicherweise bei Hippolytus die Schuld für den Tod seiner Ehefrau sucht und ihn bis zu seinem Ableben verfolgt. Auch Ariadne wird schließlich Opfer eines Konflikts zwischen zwei Männern: Dionysos ist erzürnt aufgrund der Ablehnung seines Kults durch seinen Halbbruder Perseus in Argos – es kommt zum Kampf, Ariadne gerät buchstäblich zwischen die Fronten.
Geschickt verwebt Saint bekannte Mythen mit feministischen Themen wie Emanzipation und der Hinterfragung der Rolle von Frauen in patriarchalen Strukturen. Dabei beleuchtet sie auch die Machtlosigkeit der Menschen gegenüber den Gött:innen. Ariadnes Schicksal wird zur Metapher für den Kampf um Autonomie und Selbstbestimmung in einer von Männern dominierten Welt. Im Lauf der Geschichte werden zudem weitere weibliche Schicksale wie die von Pasiphaë, Semele und Medusa ausführlich geschildert. Die Geschichten von männlichen Figuren (beispielsweise Minos, Dädalus und Ikarus, Perseus, Theseus, aber auch Dionysos) werden dabei nicht ausgespart, doch der Fokus liegt ebenso klar wie kontinuierlich auf den Frauenfiguren. Die Stärke des Romans ist insbesondere deren Charakterzeichnung: Ariadne ist eine vielschichtige Figur – mutig, verletzlich und zerrissen zwischen ihren Wünschen und den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Auch Phädra und ihr Denken, ihre Starrköpfigkeit, aber auch ihr Scharfsinn, werden eindrucksvoll dargestellt. Saint setzt sich intensiv mit den inneren Konflikten der Protagonistinnen auseinander und gibt ihnen eine Tiefe, die ihnen in den ursprünglichen Mythen oft fehlt. Die mythologische Welt wird detailliert und bildhaft beschrieben, bildet dabei jedoch vor allem die Bühne für die die Gefühle und Gedanken der Figuren, die stets im Vordergrund stehen.
Im Ullstein-Verlag weiterhin erschienen sind Saints Romane „Atalanta“ und „Elektra, die hell Leuchtende“.
Philipp Buckl, Bergische Universität Wuppertal

Februar 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Rez. zu: K. – W. Weeber, Latein und Griechisch für jeden Tag. 365 Aha-Erlebnisse. Reclam Verlag: Ditzingen 2024. EUR 10,- (ISBN 978-3-15-014606-4).
Jeder kennt einen Abreißkalender; er gibt auf jedem Blatt das jeweilige Datum an, oft befinden sich mehr oder weniger interessante Informationen zu verschiedenen Themen wie Gedenktage, Namenstage oder auch Tipps zum Kochen und Sprüche usw. Der bekannte Altertumswissenschaftler Karl-Wilhelm Weeber (W.) hat ein Buch herausgegeben, in dem die Leserinnen und Leser aufschlussreiche Details nicht nur zur antiken Kultur, sondern auch fundierte Erklärungen zu aktuellen Begriffen und Themen finden, und zwar für jeden Tag des Jahres. Er geht dabei nicht von studierten Altphilologen als Leserkreis aus, sondern erläutert in gut verständlicher Sprache die Herkunft heutiger Wörter, die im Alltagsleben eine große Rolle spielen, deren Etymologie aber den meisten verborgen ist. Auf der Titelseite verspricht der Autor 365 Aha-Erlebnisse (laut Vorwort (S. 6) hat W. 366 Vorschläge unterbreitet, da er für den 29. Februar auch einige Gedanken formuliert hat). Das Opus wurde im Jahr 2024 publiziert, das bekanntlich einen Schalttag aufweist. Es ist natürlich möglich, chronologisch vorzugehen und an jedem Tag die Überlegungen, die W. dazu präsentiert und in der Regel auf eine Druckseite komprimiert, zu lesen. Man kann aber auch an einem beliebigen Tag beginnen, und wenn man daran Gefallen gefunden hat, die Erklärungen zu mehreren Tagen lesen. Weil das genannte Jahr ein Schaltjahr war, möchte ich mit den Ausführungen des Autors zum 29. Februar beginnen.
Der Begriff „Interkalation“, Titel des Beitrags zum besagten Tag, dürfte den meisten Leserinnen und Lesern nicht geläufig sein, das Faktum, um das es hier geht, sehr wohl. W. beginnt seine Ausführungen mit einem Zitat des römischen Biographen Sueton: Annumque ad cursum solis accomodavit, ut…unus dies quarto quoque anno intercalaretur/Übersetzung: „Und er (Rez.: damit ist Caesar gemeint) passte das Jahr dem Lauf der Sonne an, so dass…nur ein einziger Tag alle vier Jahre eingeschoben werden musste“ (Sueton, Caesar 40,1). W. weist daraufhin, dass in der Zeit vor Caesar der römische Kalender immer wieder verändert werden und Schalttage, ja sogar Schaltmonate „interkaliert“ werden mussten (77). Wenn W. einen lateinischen (oder auch griechischen) Begriff verwendet, übersetzt er diesen bzw. erläutert ihn umgehend. In diesem Fall informiert er darüber, dass es Aufgabe der Priester war, einen „Zwischenruf“ zu tätigen, wenn ein Schalttag bevorstand, „so die Grundbedeutung von inter-calare“. Gewissermaßen en passant erfahren die Leserinnen und Leser, dass zwar durch die Einführung des Julianischen Kalenders die zuvor vorhandene Verwirrung (confusio) beseitigt wurde, dass aber Papst Gregor durch seine Kalenderreform 1582 eine noch größere Genauigkeit erzielte, „indem er in sog. Säkularjahren (volle Hunderte) bis auf die durch 400 teilbaren auf die Interkalation des 29. Februars verzichtet“ (77). Abschließend erklärt W. auch die Bedeutung des Begriffs Interkalation (I.) im Bereich der Chemie, wobei er ausdrücklich darauf verweist, dass die chemische I. reversibel ist – im Unterschied zur kalendarischen; so gelingt es ihm, ein weiteres lateinisches Wort (in diesem Fall: reverti, „zurückkehren“) sowie die Bedeutung des Suffix -bel (lat. -bilis) den Leserinnen und Lesern näherzubringen. W. überfrachtet die einzelnen Lemmata mit solchen Hinweisen nicht, man erfährt aber auf diese Weise zahlreiche interessante Details nicht nur zur antiken Kultur, Geschichte und Politik, sondern auch zur aktuellen Gegenwart. Ein Blick in das Register (433-439) zeigt das große Spektrum der Begriffe (von A (internationale Autokennzeichen), über Basics, CEO, GPS, Kryptobörse, MRT, Performance, Recycling, Subsidiaritätsprinzip bis Zynismus), die W. erläutert und auf ihre sprachliche Herkunft und Bedeutung hin analysiert. Im Buch werden zahlreiche Kontexte einbezogen (antikes Kulturwissen, Architektur, Medizin, Musik, Naturwissenschaften, Politik, Sport, Technik, um nur einige Beispiele zu nennen). W. stellt aber nicht nur Besonderheiten der griechischen und lateinischen Sprache vor, sondern befasst sich auch mit der deutschen Sprache, mit der bekanntlich zuweilen auch Muttersprachler ihre Probleme haben. Hier wird deutlich, dass W. nicht nur Altertumswissenschaftler ist, der auf eine große Zahl von Veröffentlichungen zur antiken Kulturgeschichte schauen kann, sondern auch Gymnasiallehrer war, der jungen Menschen die korrekte Anwendung der deutschen Sprache beigebracht hat, vor allem im Fach Latein. In diesem Zusammenhang möchte ich einige Beispiele anführen, die auf sprachliche Probleme des Deutschen hinweisen. In der Rubrik „Extremist“ (40/41) informiert W. über das lateinische Etymon (extremus) und warnt davor, einen falschen Superlativ zu verwenden („Extremst“); diesen Begriff müsste man nämlich ins Deutsche folgendermaßen übertragen: „äußersterst“, eine Wortbildung, die verständlicherweise nicht erlaubt ist. Ein ähnlicher Fall liegt beim Wort: optimal vor (optimus), zu dem weder ein Komparativ (optimaler) noch ein Superlativ (optimalst) (41) gebildet werden kann. Wer als Schülerin/Schüler die Steigerungsformen von bonus, bona, bonum korrekt gelernt hat, wird die falschen Wortbildungen mit großer Wahrscheinlichkeit vermeiden. Zuweilen verwenden Sprecher ein falsches Genus bzw. einen falschen Artikel, selbst wenn die Etymologie des Wortes eindeutig ist; dies ist etwa der Fall beim >Zölibat<, im Deutschen eindeutig ein maskulines Lexem (lat. coelibatus). W. teilt dazu mit: „Das Fremdwort >Zölibat< ist relativ nahe am >Original<. Es ist und bleibt trotz häufiger >Neutralisierung< ein Maskulinum: der Zölibat“ (91). Ein Sonderfall liegt beim Begriff: Körper vor; er geht auf das lateinische Wort corpus zurück, das eindeutig ein Neutrum ist. Beim Übergang ins Deutsche hat es „eine Geschlechtsumwandlung zum Maskulinum“ (219) erfahren. „Anders dagegen, wenn man >Corpus< oder >Korpus< als Fremdwort – z. B. bei Möbeln – verwendet. Da sollte es weiterhin >das< heißen“ (219). Wieder anders gelagert ist der Fall beim Wort Agenda, eigentlich: Dinge, die zu tun sind (233). Grammatisch handelt es sich um eine Form, die im Plural Neutrum steht. Das End-a bei Neutrumwörtern wurde schon im Mittelalter oft als Feminin begriffen, und so ist auch die Mutation zu einem femininen Wort im Deutschen zu verstehen. Bezüglich der Betonung lassen sich im Deutschen ebenfalls zahlreiche Fehler entdecken; Unkenntnis beweist, wer das Fremdwort Konsens (von lat. consentire) auf der ersten Silbe betont: Kónsens (42/43).
Ein wichtiger Bereich sind die Fremdwörter im Deutschen, die häufig mit Elementen der griechischen und lateinischen Sprache gebildet werden. Immer wieder liefert W. in diesem Kontext Beispiele für produktive Wortbildungen, vor allem bei Neologismen. Auffallend häufig greift die deutsche Sprache dabei auf Prä-, In- oder Suffixe mit griechischen und lateinischen Elementen zurück. Beliebt sind etwa Wortschöpfungen auf -tor, wobei eine handelnde Person (nomen agentis) charakterisiert wird (Administrator, Konditor, Direktor usw.), auch Bildungen mit den Suffixen -phil und -phob lassen sich beobachten (hydrophil/Wasser anziehend; hydrophob/Wasser abstoßend) (342). Zahlreich sind auch Präfixbildungen mit -a oder -an, wenn das folgende Wort mit Vokal beginnt; Beispiele: Atheist, atypisch, asynchron, aber: Anarchie. W. liefert eine Reihe von weiteren Präfixbildungen. Man mag diese Thematik möglicherweise als etwas abgehoben einschätzen, aber wenn man bedenkt, dass Medizinstudentinnen/-studenten bis zu 10000 Fachbegriffe lernen müssen, ist es ratsam, über eine Liste mit Wortbildungsmustern zu verfügen, um alle diese Wörter zu lernen und später auch stets abrufen zu können. W. macht auf einige merkwürdig anmutende Wortbildungen aufmerksam, zum Beispiel bei den Wörtern Augenoptiker und Hörakustiker („optikós bedeutet „das Sehen betreffend““ (50); sehen kann man nur mit den Augen); hier liegt also eine Tautologie vor, ebenso wie bei dem anderen genannten Wort („akoustikós „das Gehör betreffend“ (50); hören kann man eben nur mit den Ohren). Die Beispiele lassen sich beliebig erweitern.
Die Aussprache bestimmter Konsonanten war im Lateinischen nicht immer kontinuierlich; so erinnert W. daran, dass der lateinische Buchstabe -c- ursprünglich wie -k- ausgesprochen wurde, seit dem 4. Jahrhundert sprach man das -c- allerdings wie -z- aus. Die deutsche Sprache hat zum Beispiel aus cella zwei Lehnwörter entwickelt: die Zelle und der Keller (49).
Die einzelnen Lemmata, die W. zu den Tagen im Jahr vorstellt, sind nicht stupide nach einem bestimmten Schema ausgewählt, sondern variieren; manchmal wird ein Gedenktag als Aufhänger verwendet (zum Beispiel Weltkrebstag: Art. Tumorzelle (48/49, 4. Februar), Welttag für menschenwürdige Arbeit: Art. Prekariat (332/333, 7. Oktober), National Sock Day: Art. Socke (396/397, 1. bzw. 4. Dezember), manchmal eine Abkürzung (CEO, 119/120, 6. April; GPS, 237/238, 17. Juli; SUV, 280/281, 23. August), manchmal auch ein aktueller Begriff (App Store, 230, 10. Juli; Cyberspace, 305/306, 14. September; postfaktisch, 30/31, 20. Januar).
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass W. ein kurzweiliges und lesenswertes Opus verfasst hat; er bietet gut verständliche etymologische Erläuterungen, erklärt die verwendeten Fremdwörter und Lehnwörter, präsentiert nützliche Wortbildungsmuster und gibt Hinweise dafür, dass es sich lohnt, die Alten Sprachen zu erlernen, und dass insbesondere Latein als Multifunktionsfach in der Schule fungieren kann.
Rezensent: Dietmar Schmitz

Januar 2025
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Eleanor Dickey, Latin Loanwords in Ancient Greek. A Lexicon and Analysis, Cambridge (Cambridge University Press) 2023, ISBN 978-1-108-84100-9, ca. 190,00 €
Die griechisch-römische Antike ist zweisprachig. Und nicht nur die Literaturen regen einander an, auch die Sprachen tun es. Dass eine solche Anregung auch vom Lateinischen ausgehen und auf das Griechische wirken kann, dafür legt das hier vorzustellende Lexikon beredtes Zeugnis ab: Eleanor Dickey stellt darin 820 belegbare lateinische Lehnwörter im Griechischen und 1.002 mögliche Lehnwörter zusammen. Dazu kommen, den Regeln wissenschaftlicher Exaktheit folgend, über 1.000 Wörter, die entweder zwar lateinischen Ursprungs, aber keine Lehnwörter sind, oder nachantik oder nicht auf das Lateinische zurückzuführen oder gar nicht existent (sondern auf falsche Lesarten, die in ältere Lexika Eingang gefunden haben, zurückgehend) sind. In der Einleitung legt die Verfasserin die Hauptschwierigkeit dar – nämlich zu unterscheiden, wo noch Phänomene des Code Switching (also das zitierende Hinübergleiten in die andere Sprache) vorliegen und wo man bereits von lateinischen Lehnwörtern im Griechischen sprechen kann: Häufigkeit erscheint dabei als wichtigstes Kriterium, daneben sind es Phänomene morphologischer Angleichung. Der umfangreiche Lexikonteil (23–502) lädt zu einer Entdeckungsreise in Sprache und Kultur des antiken Mittelmeerraums ein: So findet das lateinische Adjektiv bonus seinen Weg ins Griechische (zu βόνος oder βῶνος) und bezeichnet die ‚Handelsgüter‘ (βόνα) in byzantinischen Texten, in denen übrigens die ‚Einführung ins römische Recht‘ ἰνστιτοῦτα heißt. Galen erwähnt ein Schmerzmittel namens ἰουκούνδα (natürlich von iucundus), und Dinge oder Personen, die mit der Getreideversorgung zu tun haben, können φρουμεντάριος (< frumentarius) heißen. Die lateinischen Monatsnamen wie Ἰανουάριος, Φεβρουάριος usw. sind ebenso bis ins moderne Griechisch lebendig geblieben wie die Bezeichnung der ‚Germanen‘ als Γερμανοί. Das neugriechische Wort für ‚Zisterne‘, nämlich στέρνα, geht über κιστέρνα auf das lateinische cisterna zurück, das Adjektiv ‚gelb‘, κίτρινος, auf citrum (‚Zitronenbaum‘) oder citrium (‚Zitrone‘) und das Wort für ‚Windel‘, φασκιά, über φασκία, auf fascia (‚Binde‘). Und natürlich steht hinter der griechischen Taverne (ταβέρνα) die lateinische taberna. Der lateinische circus gelangt, noch mit k-Aussprache, als κίρκος ins antike Griechisch und, bereits mit z-Aussprache, als τσίρκο ins moderne. Und der noch immer verwendete Ausdruck φούρνος für die Bäckerei lässt sich auf eine in die Antike zurückreichende Übernahme des lateinischen Wortes für Ofen, furnus, zurückführen. – Der Lexikonteil wird dadurch geradezu von vorne bis hinten lesbar, dass Eleanor Dickey jedes Lemma kategorisiert insbesondere in „Direct loan“ (mit Zeitangabe – das sind die interessantesten Beispiel, aus dieser Gruppe stammen auch die meisten der aufgeführten Beispiele), „rare“ (nur vereinzelt belegte Lehnwörter) und „foreign“ (Wörter, die, wenn auch transkribiert, Fremdausdrücke bleiben und nicht ins Griechische eingehen – etwa φάμουλος für famulus, ‚Diener‘). Dazu kommen noch die Einteilungen in „not Latin“, „not ancient“ und „not existent“ für Wörter, denen in antiken Lexika oder in der Forschung ein lateinischer Ursprung attestiert wird, der aber einer Prüfung nicht standhält. Der Anhang (503–667) nimmt systematische Aspekte des erfassten Sprachkontakts in den Blick: Wie werden lateinischen Lehnwörter im Griechischen geschrieben, gebeugt und akzentuiert? Wie funktioniert die Übernahme von Suffixen? Wann bleiben lateinische Fremdwörter im Griechischen erhalten? Der chronologische Überblick lässt einen Höhepunkt der Übernahmen, die mit Polybius im zweiten Jahrhundert vor Christus fassbar werden, im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus erkennen. Danach verschwinden Wörter auch wieder, einige leben, wie oben schon angedeutet, im Neugriechischen fort (dazu 589–593). Schließlich erfährt man noch, dass lateinische Wörter insbesondere in griechischen Papyrus-Urkunden, aber auch in Inschriften und literarischen Texten fassbar werden, und zwar vor allem in den Bereichen des Alltagslebens (Recht, Militär, Handel) – auch hierzu bietet die Verfasserin eine weit differenziertere Darstellung, als ein kurzer Blick hier sie auch nur annähernd fassen könnte. Besonders spannend (und vielleicht sogar eine Anregung für eine interkulturelle Vertiefung lateinischer Wortschatzarbeit?) ist der „Index of Latin Words“ (704–731). Alles in allem bietet die Verfasserin in ihrem höchst systematisch aufgebauten und akribisch zusammengetragenen Lexikon einen vorzüglichen Einblick in die bilinguale Alltagswelt und die kulturelle Vielfalt der Antike. der sowohl die neugierige Entdeckungsreise wie auch die erkenntnisorientierte Berücksichtigung unbedingt lohnt.
Stefan Freund
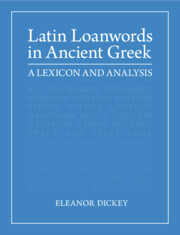
Dezember 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Holland, Tom (2024), Pax. Krieg und Frieden im Goldenen Zeitalter Roms, aus dem Englischen von Susanne Held, Stuttgart (Klett-Cotta), 440 S., 11 Karten, 33 Farbabb., ISBN 978-3-608-98758-4, 32,00 Eur., e-book 978-3-608-12232-9, 25,99 Eur.
Ὁρᾶτε γὰρ ὅτι εἰρήνην μεγάλην ὁ Καῖσαρ ἡμῖν δοκεῖ παρέχειν, ὁτι οὐκ εἰσιν οὐκέτι πόλεμοι οὐδὲ μάχαι οὐδὲ λῃστήρια μεγάλα οὐδὲ πειρατικά, ἀλλ᾿ ἔξεστιν πάσῃ ὥρᾳ ὁδεύειν, πλεῖν ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμάς („Betrachtet doch nur den tiefen Frieden, den Caesar uns verschafft hat […] Es gibt keine Kriege oder Schlachten, keine Banditen oder Piraten, und das heißt, wir können reisen, wie es uns gefällt, und von Osten nach Westen segeln“ S. 366) lauten im Wortlaut die von Holland (H.) mehr paraphrasierend zitierten Worten des Philosophen Epiktet, um den Zustand des römischen Reiches unter der Herrschaft Hadrians zu beschreiben. Diese Wertschätzung der pax Romana sei „das fundierte Urteil eines Mannes, der weithin als der weiseste Mensch der Welt angesehen wurde" (S. 366). Es habe jenseits der persönlichen Sicht seines Verfassers der Vision des Kaisers entsprochen. Auch bei den Griechen habe diese aus der Erfahrung und Einsicht heraus Anklang gefunden, dass die Folgen ihrer Kriege innerhalb der kulturellen Gemeinschaft für alle Beteiligten „ruinös“ (S. 367) gewesen seien. Deshalb hätten sie sich von der versöhnenden Idee eines Panhellenion überzeugen lassen, das den Poleis, allen voran Athen und Sparta, dauerhaften Frieden und Wohlstand gebracht habe. Fände diese Lehre aus der Geschichte doch auch heute Beachtung!
Zu den friedensichernden Maßnahmen Hadrians zählt der Verf. außerdem den Auf- und Ausbau von Barrieren an den Außengrenzen des Imperiums wie etwa den Hadrianswall in Britannien, den Limes in Germanien und Befestigungsanlagen in Numidien; sie habe der Kaiser auf seinen ausgedehnten Reisen persönlich aufgesucht und dabei die dort stationierten Legionen inspiziert. Denn er sei zu der Überzeugung gelangt, „dass Expansionen über die natürlichen Grenzen der römischen Herrschaft hinaus das gesamte Gefüge des Imperiums bedrohten, woraus folgte, dass der ehrwürdige Traum von einer Herrschaft ohne Grenzen, einer Herrschaft, die buchstäblich die gesamte Welt umfasste, nichts weiter war als Phantasterei" (S. 352).
Hadrian habe also mit dem von Vergil formulierten römischen Anspruch auf Weltherrschaft (imperium sine fine Aen. I 279) gebrochen und die Verwirklichung eines innerhalb der Grenzen gültigen Friedens in den Mittelpunkt seiner Politik gerückt. Deshalb habe er den Rückbau der Eroberungen Trajans, seines Vorgängers und Adoptivvaters, in Mesopotamien und Dakien, aber auch im Norden der britischen Insel vorgenommen und eine Konsolidierung der römischen Macht im Inneren des Imperiums durch einsatzbereite Legionen an seinen Rändern vorangetrieben, um den allgemeinen Wohlstand im römischen Reich zu fördern. Die Gefährdungen der staatlichen Stabilität und der persönlichen Lebensumstände, die nach Neros Tod immer wieder in häufigen Thronwechseln und Ambitionen einzelner seit dem Vier-Kaiser-Jahr 68/69 bestanden hätten, habe er so in eine Epoche weitgehenden Friedens überführen können. Dieser Blick auf Hadrian lässt den Rezensenten auch ausgehend vom Titel des Buches den schon oben angesprochenen, dennoch aber eher vagen Eindruck gewinnen, dass es dem Verf. um ein Lob des Friedens im römischen Reich als Modell für unsere Welt gehen könnte. Dem steht allerdings zugleich entgegen, dass H. seinen historischen Abriss mit Hadrian abbricht, ohne auf seinen Nachfolger Antonius Pius einzugehen, der das Friedensprojekt seines Adoptivvaters langjährig fortsetzte. Auch der Detail- und Episodenreichtum in der Skizzierung der anderen, meist weniger friedfertigen Kaiser von Nero bis Trajan lässt Zweifel an der vermuteten Intention des Werkes aufkommen, da es keine durchgängig klare derartige thematische Orientierung erkennbar werden lässt.
In H.s Sicht kannte die pax Romana in ihrer hadrianischen Ausprägung zudem Ambivalenzen. „So wie die Athener unter der Schirmherrschaft Hadrians ihre alte Würde wiedererlangt hatten" (S. 368), hätten sich auch die Einwohner Jerusalems 60 Jahre nach der Zerstörung der Stadt ihren Wiederaufbau und besonders ihres Tempels erhofft. „Doch {sie} sollten enttäuscht werden" (S. 371, auch S. 348). Der Bau einer neuen, nach dem nomen gentilicium Hadrians benannten colonia Aelia Capitolina anstelle der Revitalisierung Jerusalems sei als Demütigung für ein „unverbesserlich rebellisches Volk“ (S. 371) angeordnet worden. Eine solche nachdrückliche Romanisierung nach dem Vorbild Korinths sei in der Perspektive des Kaisers „der sicherste Weg {gewesen}, einen dauerhaften Frieden zu garantieren“ (S.371). Dabei verkennt H., dass Hadrian mit der Gründung der colonia in erster Linie ein Privileg an ihre Bewohner vergab, nämlich die civitas Romana und Steuerfreiheit. Dass das neue, im Zuge der Stadtgründung errichtete Jupiterheiligtum an Stelle der erhofften Erneuerung der Beth haMikdash auf dem Tempelberg gestanden habe, entspricht ebenfalls nicht der wissenschaftlichen communis opinio, wie es bei H. den Anschein erweckt. Auch die fortdauernde Erhebung des fiscus Iudaicus anstelle der Tempelsteuer sowie ein mögliches Beschneidungsverbot Hadrians dürften weniger ursächlich für den nur wenig später ausbrechenden Bar Kochba-Aufstand gewesen sein als die wirtschaftlichen Verhältnisse in Judäa. Diese Zusammenhänge hätten Erwähnung bei H. verdient.
Anders als in Griechenland sei es Hadrian in diesem Teil der römischen Welt nicht gelungen, den Grundstein für dauerhaften Frieden zu legen, vielmehr habe er die Rebellion in Judäa überaus blutig niedergeschlagen und als Symbol seiner Macht ein kaiserliches Standbild aufstellen lassen, „als wolle er die letzte Erinnerung an das niedertrampeln, was Aelia Capitolina vormals gewesen war“ (S. 386).
Gerade diese Ereignisse offenbaren in der Sicht des Autors den repressiven Charakter des römischen Friedenskonzepts Hadrians: „Der Frieden war die Frucht des Sieges – des immerwährenden Sieges“ (S. 390). Ohne dass H. Vergil erwähnt, hatte in dieser Perspektive sein Diktum auch mehr als eineinhalb Jahrhunderte später noch nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt: tu regere imperio, Romane, memento / hae tibi erunt artes, pacique imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos, Aen. VI 851-53. Frieden ist also die Anerkennung der Suprematie der Sieger durch die Unterlegenen, nicht die gleichberechtigte Anerkennung differierender Interessen. Bei der Vermittlung des Panhellenions durch Hadrian deutete H. allerdings ein an gegenseitigem Interessenausgleich orientiertes Friedenskonzept an. Insofern ist der von ihm verwendete Begriff der pax Romana nicht klar definiert und bleibt deshalb zu vage, um die Frage nach der Intention des Buches unter seinem Titel Pax schlüssig zu beantworten.
Blickt man nach der Lektüre noch einmal zurück, bleibt der Eindruck zwiespältig. Es ist angenehm unterhaltsam zu lesen, die historischen Ereignisse und ihre Bedingungen sind anschaulich dargestellt, aber man vermisst im Interesse präziser historischer Erkenntnis die kritische Auseinandersetzung mit den reichlich beigezogenen Quellen, also die Erörterung der Frage nach deren verfolgten Absichten und Perspektiven. Auch werden sie gelegentlich nachlässig zitiert, wie etwa das eingangs erwähnte Wort Epiktets. Er hat es nicht selbst hinterlassen, wie die zugehörige Anmerkung 26, S. 416, den Anschein erweckt, sondern wird bei Arrian, Epicteti dissertationes ab Arriano digestae 3.13.9. überliefert. Darüber, dass porticus, ein öfter erwähnter Bauwerkstyp, kein Wort masculini generis, sondern Femininum ist, mag man noch hinwegsehen, dass aber das Roman Climate Optimum, das mit der langen Friedenszeit unter Hadrian und Antonius Pius korreliert, unerwähnt bleibt, stellt in einem englischen Buch ein Manko dar, zumal der Buchtitel seine behandelte Epoche das Goldene Zeitalter Roms nennt. Somit bleibt als Fazit: Es bedarf wachsam kritischer Leser:innen.
Michael Wissemann
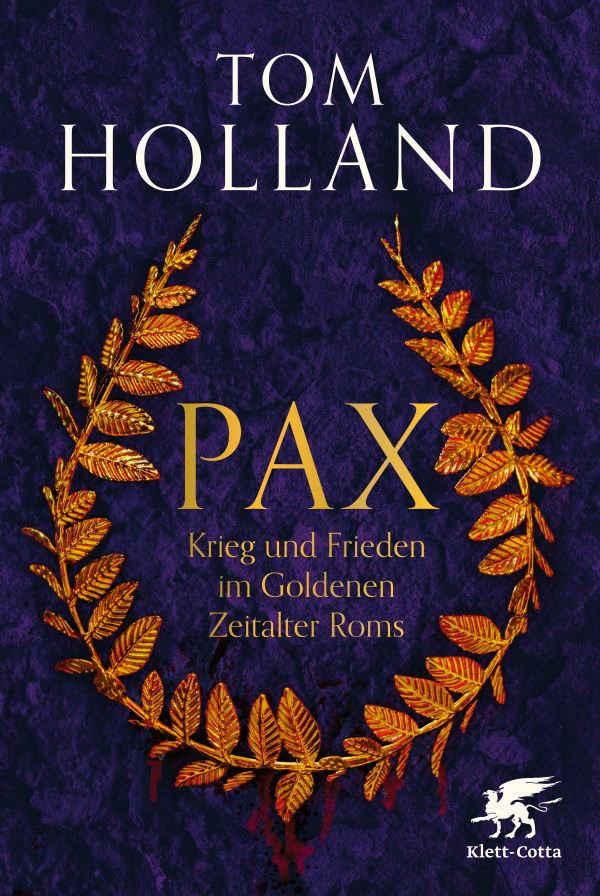
November 2024
- Details
- Hauptkategorie: Veröffentlichungen
Hose, M., Formen und Funktionen griechisch-römischer Literatur. Aufsätze zur Literaturgeschichte und Literaturgeschichtsschreibung. Hrsg. Von Annamaria Peri und Tobias Thum. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2023. EUR 99,- (ISBN 978-3-515-13411-8)
Im Vorwort erfahren die Leserinnen und Leser von den beiden Herausgebern Annamaria Peri und Tobias Thum, welchen Themen und Arbeitsgebieten sich Martin Hose (H.), Professor für griechische Philologie an der Universität München, in seinen Qualifikationsschriften gewidmet hat: den Werken des Euripides und der griechisch-römischen Geschichtsschreibung (Vorwort). Die in dem Band versammelten Beiträge verstehen sich als „Vertiefungen und Erweiterungen“ zu den „grundlegenden literaturgeschichtlichen Überblicken“ von H. (Vorwort). Dazu gehören unter anderem folgende Werke: Kleine griechische Literaturgeschichte. Von Homer bis zum Ende der Antike. München 1999; Art. „Literatur III. Griechisch“, in: Der Neue Pauly, Bd. 7, 1999, Sp. 272-288; Art. „Poesie I (Gattung und Dichtungstheorie)“, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 27, 2016, Sp. 1055-1104 sowie „Poesie III (Dichter)“, ebenda, Sp. 1153-1185. Das Buch enthält sechs Rubriken mit 41 Abhandlungen, gefolgt vom Abschnitt: Publikationshinweise (618-620) und dem Register (621-634). Da ich aus Platzgründen nur auf wenige Beiträge eingehen kann, möchte ich den Blick schwerpunktmäßig auf Erstpublikationen lenken, ohne weitere Abhandlungen ganz aus den Augen zu verlieren.
Die erste Rubrik trägt den Titel: A. Funktionen und Formen der griechischen Literatur (1-131). Gleich der erste Aufsatz befasst sich mit zwei grundlegenden Texten der griechischen Literatur: „Vom Nutzen der Widersprüchlichkeit oder Welchen Sinn hatten Ilias und Odyssee für die griechische Kultur“ (3-19). H. weist zu Beginn seiner Ausführungen mit voller Berechtigung auf das Faktum hin, das am Anfang der griechischen Literatur zwei Texte entstanden, „die bis zum Ende dieser Literatur unangefochten als deren Spitzenprodukt gelten konnten. Ja, mehr noch: die Ilias und die Odyssee stellten von der Archaik bis zum Fall Konstantinopels 1453, also für mehr als 2000 Jahre, buchstäblich die Referenztexte der griechischen Literatur dar“ (3).
Im Gegensatz zum Pentateuch und dem Judentum, dem Neuen Testament und den Christen sowie dem Koran und der islamischen Welt stellen die beiden Epen keine normativen und schon gar keine heiligen Texte dar. Es handelt sich um „lebensgesättigte Erzählungen“, die dem Mythenkreis Trojas entnommen wurden (3). In beiden Texten lassen sich „diametral entgegengesetzte Weltverständnisse narrativ explizieren“ (17), in der Odyssee garantieren die Götter eine gerechte Welt, in der Ilias sind die Götter unberechenbar gegenüber den Menschen. H. verwendet in seiner Darstellung kurze Abschnitte aus den homerischen Epen, stets im griechischen Original, aber auch mit einer deutschen Übersetzung, um seine Thesen zu untermauern. Zugleich ist er erfolgreich bemüht die Leserinnen und Leser auf den aktuellen Forschungsstand zu bringen, an dessen Diskurs er maßgeblich beteiligt ist. H. bedient sich hier wie auch in den anderen Abhandlungen eines gut lesbaren Stils, erläutert seine Thesen nachvollziehbar und bietet am Ende des Aufsatzes Hinweise auf die benutzte Literatur.
In weiteren Beiträgen der Rubrik A thematisiert H. zum Beispiel das Problem der Originalität in der griechischen Literatur, geht auf methodische Fragestellungen und auf das Verhältnis vom lyrischen Ich und der Biographie des Lyrikers ein.
Die zweite Rubrik trägt die Überschrift: B. Epochensignaturen (in) der Literatur (133-214). Nach H.‘s Auffassung ist es eine der Aufgaben von Literaturgeschichtsschreibung „zwischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten angemessen zu gewichten, um hermeneutisch brauchbare Epochen konturieren zu können“ (135). Diese Überlegungen sind vor allem für die Zeit des Hellenismus relevant. Die Forscherinnen und Forscher der Philologie haben die Abgrenzung dieser Epoche von der Geschichtswissenschaft übernommen und waren gezwungen, sie „als literarhistorischen Zeitraum (…) zu konturieren“ (135). H. arbeitet heraus, dass von einem „Rückzug ins Private“ (…) „als Signatur der hellenistischen Literatur“ nicht die Rede sein kann (149). Des Weiteren prüft H. die Position der Dichtkunst im Reich der ersten Ptolemäer, analysiert den Bedeutungsverlust der institutionellen Rhetorik im vierten Jahrhundert, wendet sich dem Wirken Klemens von Alexandrien zu, wobei es um die Grenze zwischen Christen- und Heidentum geht, und stellt die Frage, ob es eine Konstantinische Literatur gibt.
Der wechselseitigen Rezeption römischer und griechischer Literatur gilt die Rubrik: C. (215-297). Während in der Rubrik: D. Gattungen und Schreibweisen im Vordergrund stehen (299-356), sind in der Rubrik: E. Literarische Konstruktionen Ziel der Untersuchungen (357-452). Insbesondere Julian Apostata steht mit zwei Beiträgen im Zentrum der Überlegungen. Da mit diesem Kaiser ein Ausnahmefall vorliegt, weil er eine Rückkehr zum Heidentum unternahm (vgl. R. Pfeilschifter, Julian: Rückkehr zum Heidentum, in: Ders., Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher, München 2014, 90-100), zieht der folgende Beitrag ein spezifisches Interesse auf sich: „Kaiserliche Selbstentwürfe: Julian Apostata“ (393-417). Von diesem Kaiser stammen mehr Texte als von jedem anderen seiner Vorgänger. H. listet die Texte (Reden, Traktate, Briefe und Epigramme, daneben weitere Fragmente) auf (393). Er geht von einem Abschnitt aus Aurelius Victors Liber de Caesaribus (cap. 42, 20-25) aus, der an Julians Vorgänger Constantius II orientiert ist und sich deshalb als Folie eignet, da er wahrscheinlich 360 verfasst wurde und damit „ein zeitgenössisches Streiflicht auf die Anforderungen an einen Kaiser wirft“ (345). H. stellt acht Anforderungen zusammen, die sich aus dem Text des Aurelius Victor ergeben (396) und vergleicht sie mit den Selbstaussagen Julians in verschiedenen seiner Schriften.
Diese verlangten Kriterien können zwei Bereichen zugeordnet werden, nämlich den „persönlichen physischen und psychischen Eigenschaften“ und den „Fähigkeiten, die für eine ‚erfolgreiche‘ Amtsführung erforderlich sind“ (396). H. erläutert seine Perspektive unter Verwendung von mehreren Unterabschnitten, in denen der „ungefährliche Caesar“ (298ff.), der „gerechte Usurpator“ (400ff.), der „Beschützer des Reiches“ und der „Schützer der Ordnung“ (403-408), der „Oberpriester“ (408-410), der „Kaiser als πεπαιδευμένος“ (410-413) sowie die „Eigenschaften eines Kaisers“ thematisiert wurden (413-414).
Vergleicht man die Anforderungen Aurelius Victors mit den Selbstaussagen Julians scheint der Kaiser über fast alle erforderlichen Qualitäten zu verfügen, wobei lediglich ein Aspekt offenbar ausgeblendet wurde, nämlich seine praktischen militärischen Kompetenzen.
Die Rubrik F. Philologie: Konzepte, Methoden und Personen (453-617) enthält gleich drei Erstpublikationen. Der Titel des ersten dieser drei Aufsätze lautet: „Altertums- oder Literaturwissenschaft? Chancen und Gefährdungen der Gräzistik“ (486-499). Zu Beginn skizziert H. in gebotener Kürze die Entwicklung bei der Besetzung von gräzistischen Lehrstühlen in Deutschland (und Österreich) und muss konstatieren, dass im Gegensatz zu früheren Zeiten heute oft nur eine einzige Forscherin/ein einziger Forscher einen Lehrstuhl innehat und dass bei Neugründungen (etwa wie in Augsburg, Bielefeld, Braunschweig/Osnabrück und Wuppertal) ganz auf die Berufung einer Professorin/eines Professors für Gräzistik verzichtet wurde. Sodann geht H. auf die innere Entwicklung des Faches Griechisch an Universitäten bis in die aktuelle Gegenwart ein.
- H. behandelt die Leistungen einiger Fachvertreter (K. Reinhardt, P. Friedländer, W. Schadewaldt, A. Lesky, H. Erbse, um nur einige wenigen Namen zu nennen) und skizziert das Verhältnis des Faches Griechisch zu anderen Disziplinen wie Latinistik, Philosophie, Theologie, Medizin, Jurisprudenz und Theaterwissenschaften (499ff.). Es stellt sich dabei die Frage, ob die Gräzistik sich mehr als Altertums-, Kultur- oder Literaturwissenschaft versteht. H. plädiert dafür, dass das von ihm vertretene Fach seine „methodologische Basis“ erweitert bzw. modernisiert anstatt auf dem Status Quo zu verharren (497).
Gleichwohl möchte H. nicht „die traditionellen Kenntnisse an Sprache und Literatur aufgeben“ (499). Er ist Realist und erkennt sehr wohl, dass es „uns die Literaturwissenschaften auch nicht leicht machen, „aus ihrem Angebot an Theorien und Methoden zu wählen“ (499). Humor zeigt H. mit folgender abschließender Bemerkung: „Vieles ist und bleibt für uns unverständlich, weil wir die jeweiligen Sprachen der Theorien nicht genügend kennen; bei vielem kommt hinzu, dass uns der Verdacht beschleicht, dass es nicht nur für uns unverständlich ist“ (499).
Auch der folgende Beitrag ist als Erstpublikation ausgewiesen: „Vergleichen als wissenschaftliche Methode und kulturelle Praxis in der griechischen Welt. Möglichkeiten und Grenzen eines Verfahrens“ (500-517). In der griechischen Kultur spielte das Vergleichen bei Agonen und taxonomischen Ordnungen eine extrem wichtige Rolle (500). H. erläutert seine methodische Vorgehensweise und kommt dann „zu einer systematischen Betrachtung des Vergleichs als wissenschaftliche Methode“ (504). H. erinnert daran, dass in fast „allen Bereichen der Lebensäußerungen Vergleichungen auftauchen“ (507). Aristoteles stellt in der Politik politische Systeme gegenüber, ebenso tut dies Polybios in seinem Geschichtswerk, Plutarch vergleicht Dichter und Politiker, Griechen werden mit Personen anderer Völker verglichen usw. (507). H. stellt dann im weiteren Verlauf seiner Darlegungen mehrere literarische Texte vor, die in diesem Themenbereich angesiedelt sind (Vergleiche bei Homer, Platons Symposion, Abschnitte aus Herodot und Ammianus Marcellinus). Die nachfolgenden Beiträge sind in der Regel Nachrufe auf bekannte Fachvertreterinnen /Fachvertreter (U. von Wilamowitz-Moellendorff, E. Schwartz, F. Dölger, B. Snell, K. von Fritz, U. Hölscher, J. de Romilly, W. Bühler, W. Burkert und E. Vogt). Da die Ausführungen zu Uvo Hölscher als Erstpublikation deklariert sind, möge ein kurzer Blick darauf gestattet sein. Wie in anderen Beiträgen dieser Art liefert H. Grunddaten zur Biographie und beschreibt dann die Leistungen im Einzelnen. Im Gegensatz zu den anderen Persönlichkeiten des Faches gibt H. zu, U. Hölscher kaum gekannt zu haben; daher greift er auf Informationen von Hölscher selbst und auf Nachrufe anderer zurück. Neben den Publikationen des Geehrten werden zahlreiche zeitgeschichtliche Details genannt, um das Wirken von Hölscher besser einordnen zu können. Die Leserinnen und Leser erfahren nicht nur wichtige Einzelheiten eines bedeutenden Vertreters des Faches, sondern auch zahlreiche Informationen über die Entwicklungsgeschichte der Gräzistik.
Abschließend kann konstatiert werden, dass H. klare Vorstellungen entwickelt hat, welche Ziele eine griechische Literaturgeschichte in der heutigen Zeit verfolgen soll und wie das Konzept dazu aussehen kann. Der von H. gewählte zeitliche Rahmen erstreckt sich von der homerischen Epik bis in die Zeit der frühen christlichen Literatur (etwa: Synesios von Kyrene) und bleibt nicht in der Epoche des Hellenismus stehen (323 bis 30 v. Chr.) – wie viele frühere Literaturgeschichten.
H. legt Perspektiven für eine griechische Literaturgeschichte vor, die die Relevanz der griechischen Texte für die allgemeine Literaturwissenschaft wie auch für die kulturwissenschaftlich orientierte Altertumswissenschaft hervorhebt. Wer diesen Band gründlich durchgearbeitet hat, ist auf dem neuesten Forschungsstand der Gräzistik.
Dietmar Schmitz